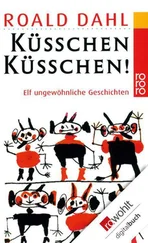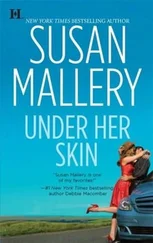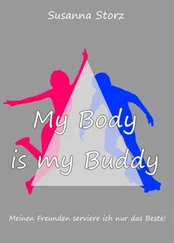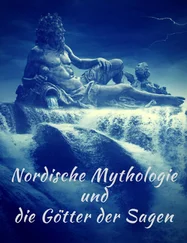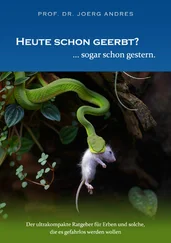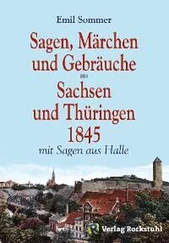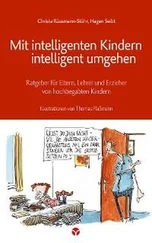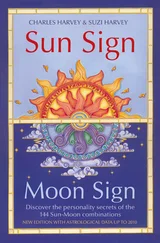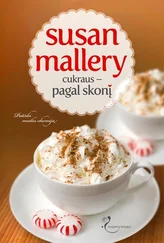Nach Verlesung der Anklageschrift berichtete Volker Schmidt aus seinem Leben: Abitur, Zivildienst, Jahre des Jobbens und der Selbstfindung. Danach Beginn eines Jurastudiums. „Pass ’ mal auf, der windet sich da raus. Der hat ja schließlich gelernt, wie der Hase läuft.“ Volkes Stimme aus dem Zuschauerraum hinter den Pressebänken. Aber Volker Schmidt war erst im zweiten Semester. Es hieße die Juristerei zu unterschätzen, wolle man bereits jedem Anfänger die Beherrschung aller ihrer Finessen zutrauen. Die Tatsache aber, dass seine Studienwahl auf den Zeitpunkt nach jenem Ereignis fiel, das sein Leben so oder so auf Dauer prägen sollte, schien ihn zusätzlich verdächtig zu machen.
Sein Verhältnis zu Frauen sei im Allgemeinen eher unverbindlich gewesen, berichtete Volker Schmidt dem Gericht. Mit seiner Freundin habe er später sogar darüber gelacht, dass die Kripo ausgerechnet ihn für Jack the Ripper halte. Es sei ihm komisch vorgekommen, denn als Pazifist liege ihm jede Gewaltanwendung fern. Daria Hillner habe er nur ein einziges Mal bewusst wahrgenommen, als er ihr eines Tages im Hausflur begegnet sei. Er habe niemals ein Wort mit ihr gewechselt, geschweige denn jemals ihre Wohnung betreten.
Und doch fand sich damals an der Innenseite seiner Jeans eine mit bloßem Auge nicht wahrnehmbare Faser ihrer pinkfarbenen Baumwollhose, die ihr Mörder ihr gewaltsam mit einem Messer vom Leib getrennt hatte.
Am Nachmittag sagte Daria Hillners 29-jährige Schwester vor dem Schwurgericht aus, wie sie zwei Tage lang versucht hatte, die junge Frau telefonisch zu erreichen. Schließlich sei sie mit ihrem Ehemann und einem Bekannten zur Wohnung der Hillners gefahren, weil sie sich Sorgen gemacht habe. Daria sei schon Tage zuvor – seit ihr Ehemann in Paris weilte – ängstlich und nervös gewesen. Julius Hillner hätte an diesem Wochenende zurückkommen sollen. Darum sei es ihr unwahrscheinlich erschienen, dass seine Ehefrau nicht zu Hause sein sollte.
Die Haustür sei – wie tagsüber üblich – unverschlossen gewesen. An der Korridortür hätten sie dann bereits das Wimmern des Säuglings gehört. Voll böser Ahnung sei sie in eine Kneipe auf der anderen Straßenseite gelaufen, um die Polizei zu alarmieren. Während sie dort gewartet hätte, seien einige Gäste hinauf zum Penthouse gerannt, wo zwei Männer inzwischen die Tür aufgebrochen hatten. So kam es, dass etliche Leute bereits bei der Leiche waren, bevor die Polizei eintraf – ein Umstand, der später die Spurensicherung erheblich durcheinanderbringen sollte.
Die 29-Jährige zeigte sich überzeugt, dass der Angeklagte der Mörder ihrer Schwester sei. Jahrelang, so berichtete sie im Zeugenstand, hätten in unregelmäßigen Abständen immer wieder rote Rosen auf Darias Grab gelegen. Sie habe überall nachgefragt, aber nie herausgefunden, von wem sie stammten. Erst mit der Verhaftung Volker Schmidts, rund fünf Jahre nach Darias Tod, habe diese unheimliche Erscheinung aufgehört.
Ein Raunen ging durch den voll besetzten Schwurgerichtssaal. Mochte auch das Gericht diesem merkwürdigen Detail keine Bedeutung beimessen, für die Zuhörer war es ein eindeutiger Schuldbeweis, und die Presse hatte ihre Schlagzeile. Auch Judith erwähnte in ihrem Bericht vom ersten Prozesstag die Rosen auf dem Grab der Ermordeten. Kein Journalist, der sein Handwerk versteht, würde sich solch eine Story entgehen lassen – so voller Mystik, wie aus einem Gruselkrimi.
Die Sonne schien nicht mehr, als Judith das Gerichtsgebäude verließ. Oktoberkühle umfing sie. In der Redaktion dagegen ging es heiß her. Endspurtstimmung. Der Prozessbericht sollte Aufmacher werden. Obwohl es bereits kurz vor Redaktionsschluss für die erste Form war, nahmen sich die meisten Kollegen noch Zeit, Judith über ihre Eindrücke auszuquetschen. Ein Verbrechen hat eben auch Unterhaltungswert – natürlich nur für denjenigen, der nicht direkt davon betroffen ist. Wer könnte das besser wissen als eine Gerichtsreporterin, die dieser Erkenntnis täglich Rechnung trägt. So zeigte sich nicht nur Polizeireporter Uli Sol interessiert. Auch Helga Weber, die ungefähr zeitgleich mit Judith aus einer offenbar langweiligen Sitzung des Grünflächenausschusses der Stadt zurückkam, bekundete lebhaftes Interesse. „Mensch Judith, ich beneide dich. Während ich mich mit der Bedeutung des fünffingrigen Waldfarns für den Westfalenpark auseinandersetzen muss – oder war es der sechsfingrige? – geht es doch bei dir wenigstens noch um was.“
„Ja, um lebenslänglich“, konterte Rufius. Als Chefredakteur war er eher an einem reibungslosen Produktionsablauf interessiert als an langen Diskussionen. Der Producer schrie bereits nach dem Material. Alles haute in die Tasten. Die Telefone schrillten. Eine Tatsache, die Robert Merten zu dieser Stunde besonders hasste. Es war die Zeit für den Kommentar des Kulturredakteurs –und nicht die für Störungen.
Judith überlegte, wie sie Robert beibringen sollte, dass sie mit Dr. Mergentheim verabredet war. Hatte er sie nicht gestern Abend gebeten, mit ihm heute eine Vernissage von irgendeinem Künstler zu besuchen, den er für sagenhaft schlecht hielt? Auch das noch. Wenn er unsicher war, legte er immer besonderen Wert auf ihr zusätzliches Urteil. Judith hatte ein gutes Gespür für falsche Töne – im Leben wie in der Kunst. Robert wusste das und war außerdem der Meinung, dass es einfach dazugehörte, alles gemeinsam zu unternehmen.
Judith dagegen scheute eine allzu enge Bindung. Sie war jetzt 40 Jahre alt und nach ihrer Scheidung vor zwei Jahren endlich wieder unabhängig. Sie wollte nicht von einer Beziehung in die nächste rutschen, fürchtete allzu sehr, dass alles wieder enden würde wie gehabt. Sie waren sich nämlich zu ähnlich, dieser Robert Merten und ihr Ex-Mann – beherrschend, ein wenig egoistisch, und vor allem besitzergreifend. Auch aus ihren Katzen machte sich der eine so wenig wie der andere. Reibungspunkte genug also. Warum noch einmal von vorn anfangen, wo doch die erdrückende Zweisamkeit endlich überwunden schien? Vielleicht war sie wirklich nicht zum Zusammenleben geeignet, wie ihr Ex-Gatte einst feststellte – allerdings erst nach zehnjähriger Ehe und nachdem er die Liebe zu einer anderen Frau entdeckt hatte. Damals ein harter Schlag für Judith. Inzwischen hatte sie ihn überwunden – nicht zuletzt durch Roberts Hilfe. Ein Grund, dankbar zu sein. Außerdem war er ein brillanter Kopf, dieser Robert Merten, und so etwas hatte Judith schon immer magisch angezogen. Seine Interessen deckten sich weitgehend mit den ihren. Aber Gespräche über Kunst und Literatur können keinen Alltag ausfüllen. Sie relativieren sich in ihrem Wert, wenn am Morgen nach einer Nacht der romantischen Übereinstimmung nur die berühmte falsch ausgedrückte Zahnpastatube oder ein bisschen von der Katze verschüttete Milch als Diskussionsstoff übrig blieben. Judith wollte Robert nicht verlieren, aber sie wollte ihr Leben auch niemals wieder mit endlosen, fruchtlosen Streitereien belasten oder über jede Minute ihres Tun und Lassens Rechenschaft ablegen.
Sie liebte es, morgens aufzustehen, wann sie es für richtig hielt. Im Bademantel zu frühstücken und das Mittagessen notfalls um 5 Uhr nachmittags einzunehmen. Zu lesen bis spät in die Nacht. Zeit zu vertrödeln. Stundenlang mit ihrer Freundin und Redaktionskollegin Helga Weber zu telefonieren oder ganz allein am Abend bei Kerzenlicht Champagner zu trinken, lediglich um einen ganz kleinen, persönlichen Erfolg zu feiern – ein bisschen berufliche Anerkennung oder auch nur ein mühsam aber richtig angebrachtes Regalbrett.
Seit sie allein in ihrer 80-Quadratmeter-City-Wohnung lebte, hielt sie viel von diesen winzigen Freuden des Lebens. Die Einrichtung hatte sie mit Bedacht ausgewählt, sozusagen als Kontrastprogramm zur früheren ehelichen Wohnung, seinerzeit männlich bestimmt und nicht ganz ohne falsche Töne. Da gab es beispielsweise ein auf dem Trödel erstandenes, altes Butterfass, das – Judith erschien es als Krone der Geschmacklosigkeit – in Mahagoni gebeizt als Schirmständer diente. Warum hatte sie sich das nur bieten lassen? Nun herrschte ihr Geschmack vor, obwohl sie einige Möbel aus ihrer Ehe mitgenommen hatte. Aber der englische Rosenholztisch vertrug sich ausgezeichnet mit der leichten Sitzgarnitur aus Korb und der konstruktivistischen Kunst an den Wänden. Sie, die früher niemals Zimmerpflanzen gemocht hatte, war nun stolz auf ihre riesigen Palmenkübel im Wohnzimmer, die in ihren Weidenkörben hervorragend mit dem Parkettboden harmonierten. Sie hatte soviel in die Wohnung investiert, dass sie nun eigentlichen recht sparsam hätte sein müssen. Aber auch daran war sie inzwischen gewöhnt. Sicherheit – auch finanzieller Art – gab es in ihrem Leben nicht mehr als allgegenwärtige Balancierstange, die man niemals losließ. Davon hatte sie sich längst frei getanzt. Ganz solo, nicht mehr im Pas de deux. Auch andere überzogen hin und wieder ihr Konto. Helga sogar ausgesprochen hemmungslos.
Читать дальше