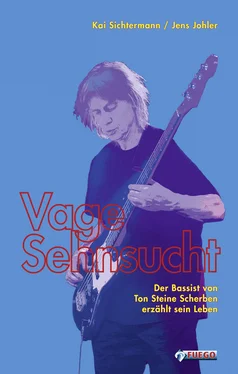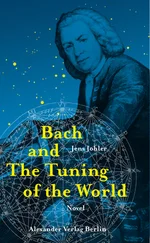Mein Gästezimmer in der Admiralstraße musste ich nach drei oder vier Wochen räumen. Das Prinzenpaar – so nannten wir Barbara und Jens inzwischen, das war eine Idee von Lanrue – hatte mir ein Zimmer bei einem Studenten in der Görlitzer Straße besorgt, in einer ziemlich tristen Gegend, nahe der Mauer. Sie fuhren mich mit meinen Sachen dorthin, und ich weiß noch, wie Barbara zu mir sagte, „So, und hier kannst du deinen Müll so hoch stapeln, bis er zur Decke reicht“. Uff, das saß! Das war ’ne echte Lektion. Und als ob das nicht gereicht hätte, folgte gleich der nächste Schock: In meinem möblierten Zimmer lag das Buch Geschichte der O , ein Sado-Maso-Roman. Es war eine gebundene Ausgabe, aber der Schutzumschlag fehlte, deswegen gab es kein Bild, das auf den Inhalt schließen ließ. Ich war zuerst völlig ahnungslos und fing unbekümmert an, darin zu lesen, bis ich irgendwann merkte, was da abging. Alter Schwede! Wie konnte sich jemand so etwas ausdenken? Ich empfand überwiegend Abscheu beim Lesen, und trotzdem habe ich immer weitergelesen. Seltsam, nicht wahr? Wahrscheinlich gehören Aversion und Faszination irgendwie zusammen; der Roman hat mich noch Jahre verfolgt. Aber lange habe ich es in der Görlitzer Straße nicht ausgehalten, ich bin dann vorübergehend zu Rio und Lanrue in die Fabriketage in der Oranienstraße gezogen, manchmal bin ich auch in irgendwelchen heruntergekommenen Szenewohnungen mit Matratzenlagern auf dem Fußboden untergekommen – alles immer in Kreuzberg. An eine kann ich mich recht gut erinnern, es war eine Zwei-Zimmer-Ladenwohnung in der Dresdener Straße, dort wohnte ich mit einem Mädel namens Rolli, die mit Opium zugange war. Wir kannten – das hat jetzt aber nichts mit dem Opium zu tun – einen netten Typen, der nachts irgendwelche Milchprodukte ausfuhr. Jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe hielt er vor unserer Wohnung und versorgte uns mit Joghurt, Fruchtquark und solchen Sachen – das war immer eine leckere Erfrischung. Da ich von meinem Vater keine Unterstützung bekam, musste ich mich irgendwie durchschlagen, „Tu was Du willst und schade niemandem“ war meine Parole. Eine Zeit lang habe ich mit Lanrue zusammen an der Uni Raubdrucke verkauft, manchmal auch beim Sklavenhändler gejobbt. Raubdrucke waren meistens vergriffene Bücher, die im Siebdruckverfahren billig nachgedruckt wurden. Ich erinnere mich an ein Buch von Anna Freud über Psychoanalyse für Kinder, und an ein anderes über das Monopolkapital, von Baran und Sweezy, die gingen besonders gut. Aber auch aktuelle Veröffentlichungen wie die von Günter Wallraff wurden nachgedruckt. Das war natürlich illegal und auch nicht fair. Doch wir haben gedacht, wir müssen ja irgendwie überleben, also was soll’s, legal, illegal, scheißegal! Sklavenhändler waren kleine Arbeitsvermittlungen, da konntest du morgens ganz früh hingehen und bekamst einen schlechtbezahlten Job für einen Tag; Rio hat einen Song darüber geschrieben: „Sklavenhändler, hast du Arbeit für mich? Sklavenhändler, ich tu’ alles für dich. Und wenn ich 7,50 verdiene, geb ich dir 3,50 ab“.
Einmal, es war in der TU-Mensa, wo Lanrue und ich diese Raubdrucke verkauften, sprach uns ein junges Pärchen an, ob wir nicht einen Schlafplatz wüssten. Charlie und Gabi hießen die beiden. Wir gaben ihnen die Adresse von der Oranienstraße, und gleich am selben Abend kamen sie bei uns vorbei. Mit Gabi habe ich mich dann ein bisschen angefreundet. Wir haben im selben Bett geschlafen, ’n bisschen geknutscht und gefummelt; damals sagte man Petting dazu. Und morgens, oder besser gesagt vormittags, nach dem Aufwachen, habe ich als Erstes auf nüchternen Magen eine Rote Hand geraucht, die filterlose Zigarette der Marke Roth-Händle, so dass mir schwindelig wurde. Ich glaube, ich mochte dieses schwindelige Gefühl. Heute schaudert es mich bei dem Gedanken – was habe ich meinem Körper bloß zugemutet?
Natürlich haben wir nicht nur Zigaretten geraucht; ich hatte schon in Lübeck erste Erfahrungen mit Haschisch gemacht. Es gab Wochenenden, da bin ich nicht nach Hause, sondern mit Kommilitonen nach Hamburg gefahren. Wir sind dann meistens einmal die Reeperbahn rauf und runter und irgendwann in dieser Underground-Disco Grünspan gelandet, da wurde dann gekifft, wenn auch maßvoll. In Berlin ging es mit dem Kiffen aber richtig los, Schwarzer Afghane, Roter Libanese, Grüner Türke, der allerdings manchmal auch aus Marokko kam. Hasch brachte nicht nur diesen völlig neuen Kick in der Birne, es löste auch den Alkohol und die Zigaretten von der Verbotsliste ab, denn ich durfte ja jetzt, mit 18 Jahren, öffentlich trinken und rauchen. Somit hatte jeder Joint, der gedreht und geraucht wurde, auch etwas Konspiratives. Das war spannend und schaffte eine besondere Art von Gemeinschaftsgefühl. „Wie hat Haschisch auf dich gewirkt?“, bin ich immer wieder gefragt worden. Es ist nicht leicht zu beschreiben. Ich wurde passiv und friedlich. Diese Friedfertigkeit habe ich auch bei allen anderen Kiffern beobachtet, mit denen ich zusammen war. Alkohol macht oft aggressiv, kiffen dagegen … Es gibt darüber einen netten Witz: Drei Drogenfreaks sitzen zusammen im Knast, ein Kokser, ein Kiffer und ein LSD-Freak. Eines Tages beschließen sie, auszubrechen. Der LSD-Freak sagt, „Wir werfen jeder einen Trip ein, dematerialisieren uns und schweben durch die Gefängnisgitter nach draußen“; „Nein“, sagt der Kokser, „wir nehmen jeder eine dicke Line, überwältigen die Wärter und brechen durch“; daraufhin meldet sich der Kiffer und sagt, „Die Ideen sind gut, aber können wir das nicht morgen machen? Lasst uns doch erst mal einen Joint rauchen.“ In der Anfangszeit meines Kifferdaseins bekam ich immer Appetit auf Süßes, habe mir Vanillepudding gekocht oder bin nachts zu einem Automaten gestiefelt, in dem es Schokolade gab. Manchmal wird man auch albern, bekommt einen Lachanfall und weiß gar nicht, warum. Aber das Wichtigste war, glaube ich, ein Gefühl von Grenzüberschreitung, ein gewisser Rausch, das Gefühl, etwas völlig Neues zu erleben. Allerdings hatte das Kiffen auch Nachteile, jedenfalls bei mir. Die Libido wurde geweckt, aber die Potenz ließ nach; das war alles andere als „herausragend“. Ich habe einige Monate gebraucht, um dahinterzukommen. Das war aber noch harmlos im Vergleich zu den Depressionen, die ich bekam. Regelmäßiges Kiffen führte bei mir zu immer stärkeren Irritationen. Beim Fahren auf der Autobahn, wenn ich unter einer Brücke oder Unterführung hindurchfuhr, hatte ich Angst, mit meinem Kopf dort oben anzuschlagen. Irgendwann kam noch Paranoia dazu. Eines Tages bin ich beim Trampen auf der Autobahn von der Polizei aufgegriffen worden und war noch froh darüber. Ich war total durch’n Wind. Einmal bin ich in so einer typischen Kifferhöhle in Kreuzberg gelandet, mit Matratzenlager auf dem Fußboden, lauter langhaarige Freaks, von denen ich niemanden kannte. Rolli hatte mich dorthin mitgenommen. Es kreisten mehrere Joints, und auf einmal wurde mir ganz schwindelig, richtig schwarz vor Augen. Ich hatte wohl zu viel intus und bekam Angstzustände. Ich stand auf, um an die frische Luft zu gehen, machte zwei, drei Schritte und fiel ohnmächtig zu Boden. Als ich nach ein paar Minuten wieder zu mir kam, war ich mit Rolli allein. Sie sagte, die anderen hätten gedacht, ich wäre tot, und seien getürmt. Aber dann, als ich nach draußen ging, war ich baff. Alles war irgendwie neu, ich befand mich in einem noch nie zuvor erlebten Bewusstseinszustand, fast paradiesisch. Ich fühlte mich einfach super, mit einem tiefen inneren Frieden. Leider hielt dieser Zustand nur ein paar Stunden an, aber ich kann ihn bis heute nicht vergessen, so wunderschön war es. Ein anderes Ereignis war dramatischer. Es war Anfang der ’80er-Jahre, ich war mit den Scherben auf Tour und hatte schon Jahre nicht mehr gekifft. Nach einem Gig trafen wir uns noch im Hotelzimmer unseres Tour-Gitarristen Dirk Schlömer, als ein Marihuana-Joint kreiste. Da ich gut drauf war und auch schon etwas angetrunken, wurde ich leichtsinnig, zog zwei oder drei Mal und merkte ziemlich schnell eine negative Wirkung. Ich ging sofort auf mein Zimmer, und spürte auf einmal einen unwiderstehlichen Sog, mich aus dem Fenster zu stürzen. Es war die nackte Todesangst, urplötzlich war sie da. Das klingt unwahrscheinlich, ich weiß, aber es war so, als ob sich ein Geist meiner bemächtigt hätte, und dieser Geist befahl mir, aus dem Fenster zu springen. Das Hotel war ein Hochhaus, ich wohnte so weit oben, dass ich einen Sturz nicht überlebt hätte. In meiner Not lief ich ohne nachzudenken ins Bad, drehte die kalte Dusche auf, setzte mich angezogen darunter und fing an zu beten. In dieser Stellung, betend unter der Dusche, verharrte ich einige Zeit – vielleicht zehn Minuten oder so -, und allmählich ließ der schreckliche Sog nach. Und es blieb dabei: Je länger ich kiffte, desto mieser fühlte ich mich, und trotzdem hörte ich nicht auf damit, völlig absurd. Ich glaube, ich habe immer gehofft, die allerersten Zustände, die ja positiv waren, noch einmal wiederzuerleben. Doch dann, nach circa zwei bis drei Jahren, so gegen Ende ’72, habe ich konsequent aufgehört und stattdessen angefangen, Whiskey zu trinken. War deutlich bekömmlicher! Meine Lieblingsmarke war Jim Beam, ein Bourbon aus Kentucky. Der wurde zu meinem kleinen Helferlein, immer und überall gegenwärtig, so wie der kleine Glühbirnenroboter von Daniel Düsentrieb. Aber richtig betrunken habe ich mich, abgesehen von einigen Reisen nach Kentucky, selten. Hier muss ich wieder an den Trinkspruch von Werner Rieger denken: „Rein Gottes Wort“; es war fast so, als würde Jim Beam mir dabei helfen, den Anschluss nach „oben“ nicht zu verlieren.
Читать дальше