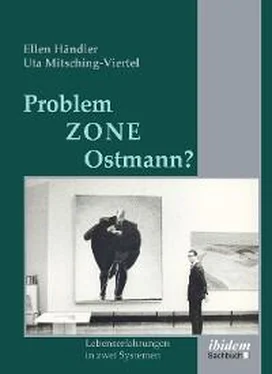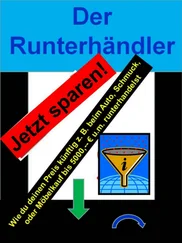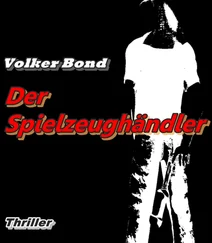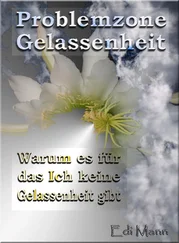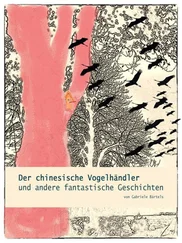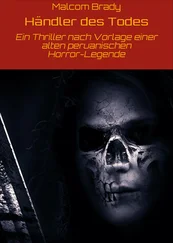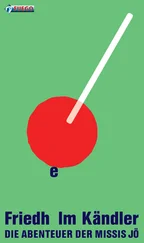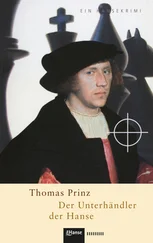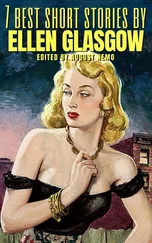Ellen Händler - Problemzone Ostmann?
Здесь есть возможность читать онлайн «Ellen Händler - Problemzone Ostmann?» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Problemzone Ostmann?
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Problemzone Ostmann?: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Problemzone Ostmann?»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Problemzone Ostmann? — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Problemzone Ostmann?», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
In der DDR hat der normale Werktätige, so wie ich ihn kenne, relativ wenig verdient. Durch Überstunden und Schichtdienst konnten sie den Lohn etwas aufbessern. Die Arbeiter hatten aber auch bestimmte Privilegien, sie konnten nicht so exakt die Arbeitszeit einhalten, sich Kraft für den Feierabend aufsparen. Die zeitlichen Normen waren gut auskömmlich, was den Ostmännern im Westen aufstieß. Der Westen hat sich auch mit Leistungen, mit Ängsten, mit viel Tränen, mit Insolvenzen entwickelt. Dies haben die Ostdeutschen im Westfernsehen aber nie gesehen. Ich habe so das Gefühl, dass viele Ostdeutsche die Vorstellung hatten: »Hier in der DDR werde ich nichts durch meine Arbeit. Wenn ich drüben wäre, dann werde ich was.« Das war der goldene Traum. Dass dieser Traum nur durch Leistung wahr werden kann, bedeutet für den Ostdeutschen: Er muss sich anpassen, er muss sich verändern, er muss sich darauf einstellen, die geforderte Leistung unter großem Einsatz zu erbringen. Für manche ist diese Umstellung sehr schwierig. Ich bin nicht von Arbeitslosigkeit betroffen gewesen, zum Glück. Sehr viele traf es völlig unverschuldet. Plötzlich ohne Selbstverschulden und ohne Chancen aus einem sehr sicheren Arbeitsverhältnis in der DDR in ein unsicheres Leben zu gehen, hat sehr viele in Resignation und einige in Aggression getrieben.
Insofern ist ein kleinerer Teil der Ostmänner in der heutigen Bundesrepublik nicht angekommen. Menschen, die oft arbeitslos waren, heute mit Hartz IV leben, für die ist es schwierig, auch weil die Renten so klein bleiben werden. Ja, wir hatten in der DDR ein ausgeprägtes Sozialsystem, manche haben sich auch in diesem Sozialsystem eingerichtet. Manchen fehlt der Anreiz, wieder arbeiten zu wollen. Ja, wir haben mehr Freiheit bekommen, aber dieses Mehr an Freiheit bedeutet auch, dass man sie selbst gestalten muss.
Für mich war die DDR meine Jugend. Das bedeutet, dass man Ziele hat, etwas für die Gesellschaft tun will. Die gesellschaftlichen Ziele des Sozialismus hat die DDR geschickt ganz nach oben gestellt. Dabei verschwieg man die Widersprüche, die sie auch prägten. In mir ist allerdings nach wie vor der gesamtgesellschaftliche Gedanke, das Arbeiten für die Gesellschaft bedeutend. Dies hat sich verändert. Heute steht die Gestaltung des Individuums vor dem Gesellschaftlichen. Diesen Widerspruch in der DDR zwischen dem tatsächlichen Erleben und dem gesellschaftlichen Anspruch habe ich auch in mir gespürt. Ich habe mich gesellschaftlich in einem sehr starken Überwachungsstaat engagiert. Dieses Überwachen, das überall Hineinlenken und Leiten, sehe ich sehr kritisch. Auch wie man mit der Intelligenz umging, dass ich im Klassenbuch meiner Kinder als Unternehmer geführt wurde und dass dort stand, wer in welcher Partei war, welchen Beruf die Eltern hatten. Das ging zu weit. Eine andere Sache ist, was sie für die Gleichberechtigung der Frau getan haben, auch wenn sie sie als Arbeitskraft brauchten. Frauen wurden bedeutend besser gefördert als im Westen. Ich kann mich noch über das Erstaunen meine Frau erinnern, als sie ein Konto bei einer westdeutschen Bank nach der Wende eröffnen wollte und um meine Zustimmung gebeten wurde.
Nach wie vor stört mich die Bewertung derer, die uns die Freiheit zur Wende brachten. Dass die ehemalige SED als Partei weiter existieren kann, sich nie grundlegend mit ihren Fehlern auseinandersetzen musste, sich nicht neu gründete, sondern mit den alten Kadern weitergeführt wurde, finde ich nicht in Ordnung. Den rechten Rand, deren Forderungen und Hass, zum Beispiel gegen die Juden, kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Andererseits muss man aber bestimmte Themen, die auch von der AfD aufgegriffen werden, diskutieren. Man darf sie nicht totschweigen. Dass das nicht funktioniert, haben wir in der DDR erlebt. Es wird in der Gesellschaft immer unterschiedliche Ansichten geben, von Links, Mitte und Rechts. Man muss über diese intensiv diskutieren und natürlich Auswüchse mit dem Rechtsstaat bekämpfen. Ich würde mir wünschen, dass man sich heute nach über 30 Jahren mehr und intensiver mit der DDR-Geschichte, den Parteien, mit dem widersprüchlichen Leben auseinandersetzt.
Alfred, Jahrgang 1929 | 3 Kinder, verwitwet
Ost: Werkzeugmacher, Pionierleiter West: Tierparkbegleiter
Jugendherbergsleiter, Produktionslenker
FDJ* – diese drei Buchstaben gehören zu meinem Leben
wie Vater und Mutter
Das letzte Aufgebot, ich gehörte dazu. 15-jährig waren meine Klassenkameraden für »Führer und Vaterland« als Soldaten der HJ-Division Dresden in Altenberg/Erzgebirge von der SS in den Tod getrieben worden. Nur einem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass ich zu diesem Zeitpunkt, am 9. Mai 1945, nicht mehr Teil dieser Einheit war. Für mich war der Krieg zu Ende, als einige Tage vorher unsere Gruppe im Müglitztal Panzer der Roten Armee mit unseren Panzerfäusten aufhalten sollten. Aber es kamen keine. Ein junger Leutnant der Wehrmacht fragte, ob wir mit ihm zu den Amis durchbrechen wollten. Wir wollten. So landeten Karabiner und Munition im Fluss.
FDJ* – diese drei Buchstaben gehören zu meinem Leben wie Vater und Mutter. Es waren junge Antifaschisten der Antifa-Jugend Loschwitz und später die Kommunisten im Werkzeugbau des Sachsenwerkes/Niedersedlitz, die mir halfen, das faschistische Gedankengut aus dem Gehirn zu schwemmen. Elternhaus, Schule, Jungvolk und Hitlerjugend hatten es von früher Kindheit an bei mir und vielen meiner Altersgenossen tief im Kopf verwurzelt. Immer mehr wurde mir klar, was wir doch für eine betrogene Generation waren. Der größte Teil meiner ehemaligen Klassenkameraden aus der 17. Volksschule Dresden konnte diesen Prozess nicht mehr erleben. Sie waren für »Volk und Vaterland« gestorben.
Im Sachsenwerk/Niedersedlitz (SW) hatte ich meine Lehre als Werkzeugmacher 1943 begonnen und 1946 mit der Facharbeiterprüfung im »Roten Werkzeugbau« bestanden. Dies hieß so, weil hier eine Gruppe von Kommunisten tätig war, die während der Nazizeit als Mitglieder der VKA (Vereinigte Kletterabteilung, auch »Rote Bergsteiger« genannt) aktiv gegen die Nazis kämpften und dafür kurz nach der Machtergreifung der Nazis 1933 in eines der ersten Konzentrationslager, die Burg Hohnstein (Sächsische Schweiz), verbracht wurden. Gebrochen werden konnten sie aber nicht. Anfang März 1946 hatte ich ein Erlebnis, welches für mein Leben von großer Bedeutung werden sollte. Ich begleitete meine neuen Freunde der Antifa-Jugend Loschwitz in den Saal des Sachsenverlag Dresden. Hier fand die Gründung der FDJ* in Sachsen statt. Der Saal war brechend voll mit Jungen und Mädchen und ihren älteren Gefährten. Ich stand ganz hinten am Eingang. Ich gehörte ja nicht dazu, war nur Gast. Es wurden Reden gehalten. Das meiste verstand ich nicht. Alles war so neu, obwohl es die Sprache meiner Loschwitzer Freunde war. Am Schluss sang ein Chor ein Lied – und viele stimmten ein, nur einer nicht. Ich! »Es rosten die starken Maschinen ...« Das war die Sprache, die jeder verstand. Ich wollte mitmachen. So wurde ich am 13. September 1946 als Mitglied der FDJ* im Sachsenwerk aufgenommen.
Die FDJ-Gruppe von nicht einmal 30 Freunden wurde meine erste politische Heimat nach dem Krieg. Mitte 1948 wurde die FDJ-Leitung zu unserem sowjetischen Generaldirektor des SDAG* eingeladen. Noch in Uniform der Sowjetarmee hörte er sich unsere Nöte an. Dann sagte er: »Ihr müsst einen Wettbewerb machen. Kommt wieder und schreibt auf, was ihr als Prämien ausgeben wollt.« So entstand die Idee unseres ersten innerbetrieblichen Wettbewerbs. Viele Prämien wurden gebaut. Ich gehörte zu einer Gruppe, die Spielzeug für die Betriebskinder aus Blech bastelten. Am Schluss konnten sich viele Kinder über die Mini-Trümmerlok mit ihren Loren freuen. Mit solchen Initiativen wuchs unsere FDJ-Gruppe bis Ende 1948 auf über 300 Freunde. Von meinen Freunden wurde ich im März 1949 zum hauptamtlichen Pionierleiter gewählt und begann am 1. April meine Tätigkeit an der 88. Grundschule in Dresden-Pillnitz. Für die 180 Schulen gab es damals acht Pionierleiter. Nur wenige hatten zuvor mit Kindern gearbeitet. Logisch, dass wir zusammenhielten, wie eine kleine Familie. Wir teilten oft unser (karges) Brot, wie Geschwister. Als Werkzeugmacher verdiente ich immerhin um die 400 Mark. Das war damals ein recht guter Lohn. Natürlich nicht im Verhältnis zu den Schwarzmarktpreisen: Zwei Kilogramm Brot kosteten 80 Mark, eine (!) Zigarette im Schnitt drei Mark. Unser ›fürstliches Gehalt‹ als Pionierleiter betrug lange Zeit monatlich 180 Mark (brutto), das waren 168 Mark netto, und reichte vorne und hinten nicht.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Problemzone Ostmann?»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Problemzone Ostmann?» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Problemzone Ostmann?» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.