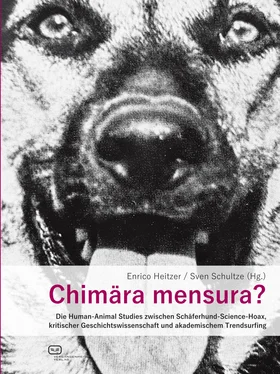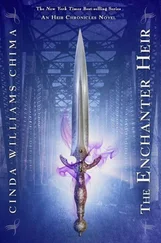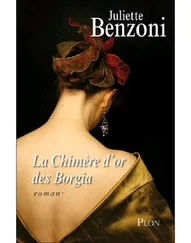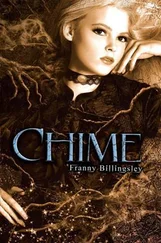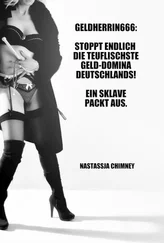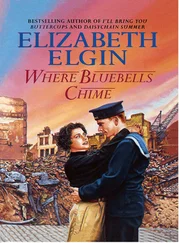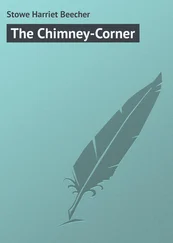Bedanken möchten wir uns beim Vergangenheitsverlag, der an uns mit der Möglichkeit zur Veröffentlichung herantrat. Mit dem Verleger Alexander Schug haben wir dann eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um die benötigten Gelder zusammen zu bekommen. Dank der Unterstützung von 41 Menschen ist dies auch tatsächlich gelungen. Vielen Dank an alle! Durch das Crowdfunding war es möglich, schnell und unabhängig von äußerer Einflussnahme durch übliche Formen der Finanzierung, die Publikation zu realisieren.
Auch den Titel, nach dem wir lange gesucht haben, müssen wir kurz erläutern: Es ist vermutlich klar geworden, dass sich „Chimära mensura?“ auf den homo-mensura-Satz (in der lateinischen Übersetzung) des Sophisten Protagoras bezieht. Nach ihm also sei der Mensch das Maß aller Dinge. Eine Chimäre ist in der griechischen Mythologie ein Mischwesen zwischen Mensch und Tier, aber aber auch ein Fantasiegebilde. In den untiefen Gefilden tierlicher Hermeneutik fanden wir diesen semantisch mehrschichtigen Ausdruck also durchaus (zu)treffend. Überdies hatte der bekannte Evolutionsbiologe Richard Dawkins schon vor Jahren die Schaffung einer „Chimäre“ vorgeschlagen, also der Kreuzung von Mensch und Tier in Form eines Mischwesens aus Mensch und Schimpanse, um dadurch eine „heilsame Erschütterung“ auszulösen für die auf Menschen fixierte Ethik. 88Natürlich ist auch eine Anspielung auf den Chimaira AK enthalten, der im „Kontext der Gesellschaftlichen Mensch-Tier-Verhältnisse“ mit seiner „Namensgebung auf die machtvollen Prozesse hinweisen“ möchte, „im Zuge derer die Grenzen zwischen Menschen und nichtmenschlichen Tieren gezogen und naturalisiert werden“. 89
Die Publikation ist zweigeteilt. Der erste Teil ist als eine Art Debatten-Reader zu verstehen. Hier haben wir die wesentlichen Texte des Hoaxes und der anschließenden Debatte aufgenommen. Dazu gehört auch der mittlerweile nicht mehr verfügbare Artikel von „Schulte“ aus der Zeitschrift „Totalitarismus und Demokratie“. Die Herausgeber bedanken sich beim Verlag Vandenhoeck & Ruprecht und beim Redaktionsleiter Prof. Dr. Uwe Backes, dass sie fairer- und freundlicherweise die Erlaubnis erteilten, den Aufsatz in unseren Band aufnehmen zu dürfen. Wir haben uns allerdings dafür entschieden, die Tagungsfassung abzudrucken, die bislang nicht öffentlich verfügbar war. Die wesentlichen Änderungen zwischen dieser und der publizierten Fassung sind in einer editorischen Notiz beschrieben. Es folgen die Interviews, in denen sich „Schulte“ sowie Betroffene des Hoaxes in der Zeitschrift sub\urban geäußert haben. Wir bedanken uns auch in diesem Fall bei der Redaktion und den Interviewten für die freundliche Abdruckgenehmigung.
Der zweite Teil des Bandes ist so untergliedert, dass er die Struktur des Workshops und damit die einzelnen Problemebenen, die wir durch den Schäferhund-Hoax berührt sehen, teilweise reflektiert, ihn teilweise aber auch verlässt. Zu Beginn steht ein kurzes Geleitwort von Peter Boghossian, der kürzlich als Koautor des Nonsens-Aufsatzes über den „konzeptionellen Penis“ als Ursache des Klimawandels in Erscheinung getreten ist, der im Mai 2017 in der Zeitschrift „Cogent Social Sciences“ veröffentlicht und bald als Hoax mit einer ähnlichen Stoßrichtung enttarnt wurde, eröffnen. Boghossian zufolge sind Wissenschaftshoaxes wichtig und ethisch geboten. Es folgen Beiträge, die aus Statements auf dem Workshop hervorgehen, aber auch eigens geschriebene Artikel, die aus unterschiedlichen Perspektiven eine Analyse des klug platzierten Hunde-Hoaxes bieten.
Einleitend wird sich Sven Schultze kritisch mit den HAS auseinandersetzen. Aus seiner Sicht sind antirealistische Forschungskonzepte innerhalb der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften derzeit tonangebend. Der Schäferhund-Hoax verweise deshalb innerhalb des Spannungsfeldes zwischen postmodernem „ge-turne“, Konstruktion und Dekonstruktion, kulturalistischer Wende und Performanz auf die unverändert akuten Schwierigkeiten geisteswissenschaftlicher Epistemologie. Die primären Fragen dabei sind, welches Wissenschaftsverständnis den deutschsprachigen HAS eigen ist und welcher wissenschaftliche Stellenwert ihnen zukommen könnte. Der Reptilienforscher Heiko Werning setzt die kritische Betrachtung der Prämissen der HAS aus der Perspektive eines Biologen und Verhaltensforschers fort. Der Soziologe und Politologe Markus Kurth vom Chimaira AK folgt mit einer Verteidigung der HAS gegen die Angriffe von „Christiane Schulte“, die er vor allem als Ausdruck eines Streits um politische Deutungshoheit versteht.
Für den Hoax-Beteiligten Florian Peters stellt sich der „Schäferhund-Hoax“ als Symptom akademischen Trendsurfings dar. Der fingierte Artikel habe durchaus übliche Strategien zur Generierung innerwissenschaftlicher Distinktions- und Aufmerksamkeitsgewinne aufgegriffen und diese lediglich auf die Spitze getrieben. Der Hoax sei nicht als Einzelfall zu belächeln, sondern als Symptom eines Wissenschaftsbetriebs zu reflektieren, der mehr denn je auf organisierter Konkurrenz statt auf öffentlicher Kritik als Modus der Wissensproduktion basiere. Anders akzentuiert der Soziologe Thomas Hoebel, der sich dem Hoax aus der Perspektive des Simon & Garfinkel-Prinzips zuwendet, einer von Randall Collins geprägten Denkfigur, mit der versucht wird, das Phänomen zu beschreiben, dass in der alltäglichen – und seiner Ansicht nach auch zu häufig auch in der Wissenschaftskommunikation – selbst die absurdesten Dinge akzeptiert und „normalisiert“ werden.
Enrico Heitzer geht in seinem Beitrag der Frage nach, welche Faktoren es ermöglichten, einem fachkundigen Publikum im Gewande einer Untersuchung über Schäferhunde kaltschnäuzig eine derart holzschnittartige Geschichtsinterpretation unterzuschieben, deren zentrale Interpretamente brachial-vereindeutigende totalitarismustheorische Muster bedienen.
Die Politikwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin Antonia Schmid und der Soziologe und Kulturwissenschaftler Peter Ullrich gehen auf ein weiteres Problem ein, auf das der Hoax aufmerksam gemacht hat. Das ironisch Vorexerzierte stellt ihrer Ansicht nach Zwänge bloß, denen selbstunternehmerisch sich stets optimierende Wissensarbeiter*innen im akademischen Kapitalismus unterliegen, insbesondere den Druck zu herausgehobener Sichtbarkeit – „Publish or perish“ – und Innovationen. Das habe den ungewollten Nebeneffekt einer schieren Inflation wissenschaftlicher Texte, die mehrheitlich weder gelesen noch zitiert werden. Zudem hätten die Reputationskriterien, die sich dominant am Publizieren festmachen, eine Vergeschlechtlichung der akademischen Arbeitsteilung zur Folge. Weiblich codierte „Reproduktionstätigkeiten“ (Lehre, oft unbezahlte Lehraufträge) würden unsichtbar gemacht und entwertet; männlich Codiertes hingegen bringe Aufstiegschancen. Der Sozialpsychologe Oliver Lauenstein setzt sich mit dem Verhältnis von Humor und Kritik im Hoax auseinander, leitet dann zum Hoax als Kritik von außen über und beschließt seinen Beitrag, nach einem Exkurs zu den in „der positivistisch-empirischen Wissenschaft im Argen liegenden Punkten“, mit Humor als Selbstkritik in Form des „Scherzartikels“. Er bezieht eine andere Position als die Herausgeber, die hoffen, damit nicht selbst Ziel eines „Scherzartikels“ geworden zu sein. Abschließend stellt der Historiker Heiner Stahl retrospektiv Wahrnehmung und Einschätzung seiner Studierenden in Bezug auf den Schäferhund-Text dar, den er als Lektüre in einem BA-Seminar zu Theorien und Ansätzen der Geschichtswissenschaften platzierte, ohne den Hoax vorher offenzulegen. Er verbindet die Selbstzeugnisse der Studierenden mit einer Kritik an Entwicklungen des Bildungssystems.
Die Herausgeber im Dezember 2017
_______________
1 Irmer, Juliette, Natur-Entfremdung. Kinder kommen immer weniger in die Natur, in: Spektrum der Wissenschaft (05.10.2017), http://www.spektrum.de/news/natur-entfremdung-kinder-kommen-immer-weniger-in-die-natur/1507953 (zugegriffen am 08.10.2017).
Читать дальше