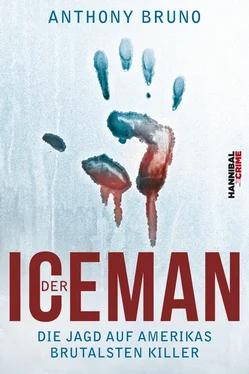Am nächsten Morgen blieb er länger im Bett und trödelte absichtlich herum, bis er allein war. Er würde nie mehr in die Schule gehen, nie wieder einen Fuß nach draußen setzen, und bestimmt war er sowieso bald tot, weil er ständig brechen musste. Keinen Bissen behielt er bei sich, und irgendwann würde er verhungern.
Regungslos lag er im Bett, dachte an Johnny und an diesen schrecklichen Moment, wenn die Bullen die Tür eintreten würden.
Aber dieser Moment kam nicht.
Die ganze restliche Woche blieb er zu Hause, quälte sich mit seinen Ängsten, rannte auf und ab, schwitzte.
Doch nichts passierte.
Die Nonnen erkundigten sich bei seiner Mutter, weshalb er tagelang nicht zur Schule gekommen sei und warum sie keine Entschuldigung geschickt habe, wenn er krank sei. Sie tobte vor Wut über seine Verschlagenheit und prügelte ihn mit dem Besenstiel durch. Außerdem schickte sie ihn am Sonntag zur Strafe in die Kirche. Schweißgebadet saß er in der Messe und schaute sich immer wieder verstohlen um, ob nicht schon ein Junge aus der Bande auf ihn deutete, der gleich herausbrüllen würde, dass Richard Kuklinski der Mörder von Johnny war.
Doch nichts passierte.
Am Montagmorgen sagte er seiner Mutter, dass er wirklich krank sei, aber sie glaubte ihm kein Wort und zwang ihn, mit ihr gemeinsam die Wohnung zu verlassen. Auf dem Weg zur Schule versuchte er, sich so gut es ging zusammenzunehmen. Trotzdem erstarrte er jedesmal vor Schreck, wenn er ein Auto näherkommen hörte. Ständig erwartete er, dass ein Streifenwagen anhielt und ihn mitnahm.
Doch nichts passierte.
In der Schule konnte er nicht aufpassen, und die Nonne, die Unterricht gab, schalt ihn mehrmals, weil er in den Tag hinein träumte. Wenn mich irgend jemand verpfeift, dann sie, dachte er. Nonnen witterten Sünder schon aus meilenweiter Entfernung. Er rechnete dauernd damit, dass sie losschrie und ihn anklagte, woraufhin die Bullen ins Klassenzimmer stürmen und ihn wegzerren würden.
Aber nichts passierte.
Es passierte einfach gar nichts.
Fast zwei Wochen waren seit dieser Nacht im Hof vergangen, und keiner war auch nur mit einer Frage zu ihm gekommen. Keine Bullen, keines der Kinder aus der Bande, keiner aus Johnnys Familie, nicht mal Mr. Butterfield. Überhaupt niemand.
Allerdings war er fest überzeugt, dass es bloß eine Falle war. Sie verstellten sich alle. Die Polizei wartete nur auf den richtigen Moment, ehe sie zuschlug. Es war bestimmt eine Falle.
Ihm kam der Gedanke, dass Johnny womöglich gar nicht tot war. Irgendwann würde er in den nächsten Tagen die Straße entlanggehen und plötzlich Johnny gegenüberstehen, den die Polizei die ganze Zeit über in einem Krankenhaus versteckt hatte. Er würde auf ihn zeigen und den Bullen zurufen: »Das ist er. Der magere Polacke ist der Kerl, der mich umbringen wollte.«
Richie konnte nicht essen, er konnte nicht schlafen und fürchtete sich davor, einen Fuß aus dem Haus zu setzen.
Aber nichts passierte. Absolut nichts.
Allmählich begann er sich zu beruhigen. Vielleicht wusste es tatsächlich niemand. Vielleicht war ja alles gut. Eines Tages ertappte er sich dabei, wie er lächelte, und er merkte, dass er überhaupt nicht mehr an Johnny gedacht hatte: Er begann wieder öfter nach draußen zu gehen, und schließlich hörte er damit auf, hinter jeder Ecke ein Polizeiauto zu erwarten. Er dachte zwar noch an Johnny; aber es quälte ihn nicht mehr sonderlich. Statt dessen fühlte er sich allmählich irgendwie richtig großartig. Der Tyrann war weg; die Schikanen hatten ein Ende, und er hatte seine Ruhe. So einfach konnte man also mit Gewalt seine Probleme lösen.
Im Laufe der folgenden Monate tauchten immer mal wieder im Haus Ermittlungsbeamte auf, um die Nachbarn wegen Johnny zu befragen und zu hören, ob es irgendwelche neuen Informationen gab. Richie ging jedesmal ungerührt an ihnen vorbei und verbiss sich ein Grinsen. Nur er wusste, wer Johnny getötet hatte – und niemand sonst. Es war sein kleines Geheimnis, das ihm ganz allein gehörte. Kein Mensch auf der Welt kannte es, nur er; und es stellte ihn irgendwie über die anderen. Es machte ihn zu etwas Besonderem. Er war jemand.

Die Türklingel läutete. Der einundfünfzigjährige Richard Kuklinski schaute nur flüchtig vom Bildschirm hoch. Seine Frau Barbara war mit den Töchtern Merrick und Christen zum Einkaufen weg, aber sein Sohn Dwayne musste irgendwo im Haus sein. Er würde schon öffnen. Kuklinski ging nie selbst an die Tür.
Es läutete erneut, und Shaba, der Neufundländer, erwachte aus seinem Nickerchen. Der zottelige schwarze Hund war groß wie ein Bär. Kuklinski hatte ihn völlig entkräftet in einem Müllcontainer gefunden, zusammen mit zwei weiteren Welpen, die bereits tot waren. Der Name des Hundes bedeutete auf polnisch ›kleiner Frosch‹. Sie hatten ihn so genannt, weil er, wie alle Neufundländer, zwischen den Zehen seiner großen Pfoten Schwimmhäute hatte und, ehe er laufen konnte, im Haus herumhopste wie ein Frosch.
Die Klingel läutete ein drittes Mal. Der große Hund öffnete die Augen und knurrte.
Kuklinski strich ihm über den Kopf. »Schon gut, Shaba. Alles in Ordnung. Dwayne! Geh aufmachen.«
Wieder läutete es. Der Hund stand auf und trottete bellend in den Flur. »Dwayne?« Es kam keine Antwort. Anscheinend war er nach draußen gegangen.
Shaba kläffte inzwischen an der Haustür. »Sei, still«, brummte er und versuchte, sich auf den Film zu konzentrieren.
Erneut schellte es, und der Hund wurde immer wilder.
»Scheiße.« Fluchend stemmte Kuklinski seine 270 Pfund schwere und 1,93 große Gestalt aus dem Sofa.
»Shaba«, rief er. »Klappe.«
Das Tier gehorchte nicht, was keineswegs ungewöhnlich war, aber Kuklinski geriet dadurch noch mehr in Wut. Garantiert standen da draußen bloß wieder diese verdammten Zeugen Jehovas. Er würde dafür sorgen, dass sie bereuten, ihn heute morgen belästigt zu haben.
An der Eingangstür packte er Shabas Halsband, ehe er den Riegel zurückschob und ein paar Zentimeter öffnete.
»Was ist?«, fauchte er. Shaba sträubte sich heftig gegen seinen Griff.
Zwei breitschultrige Männer, korrekt bekleidet mit Anzug und Krawatte, standen vor ihm. Einer hielt eine Dienstmarke hoch. »Mr. Richard Kuklinski?«
Kuklinski öffnete die Tür ein Stück weiter und musterte kritisch die Marke. »Ja? Kann ich Ihnen helfen?«
»Ich bin Detective Volkman von der New Jersey State Police, und das ist Detective Kane. Wir möchten Ihnen ein paar Fragen stellen.«
»Worum geht’s?«
»Verschiedene Morde.«
»Ich weiß nichts von irgendwelchen Morden.«
Shaba versuchte knurrend, sich loszureißen.
»Haben Sie einen George Malliband Junior gekannt?«, fragte Detective Volkman.
Kuklinski schüttelte den Kopf.
»Und einen gewissen Louis Masgay?«
»Nein.«
Detective Kane, der Jüngere der beiden, sagte kein Wort und starrte ihn einfach nur finster an. Kuklinski kannte diese Spielchen. Sie waren nicht die ersten Bullen, die hier auftauchten und dumme Fragen stellten. Volkman, der Sprecher, würde sich nett und freundlich geben, Kane würde den bösartigen Fiesling spielen. Er hätte ihnen am liebsten ins Gesicht gelacht. Was glaubten diese Burschen, wer sie waren? Oder besser gesagt – was glaubten sie, mit wem sie es zu tun hatten?
»Wie ist es mit Paul L. Hoffman?«, fragte Volkman. »Haben Sie den gekannt?«
Kuklinski verneinte kopfschüttelnd.
»Gary Thomas Smith?«
»Nee.«
»Und Daniel Everett Deppner?«
Kuklinski riss scharf an Shabas Halsband, um den aufgebrachten Hund zu bändigen. »Auch noch nie gehört.« Er behielt die Hand an der Tür, um sie jederzeit zuschlagen zu können.
Читать дальше