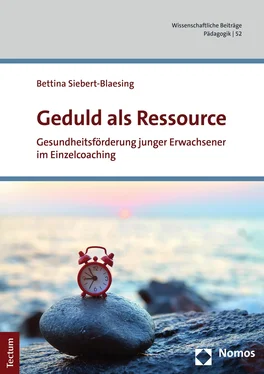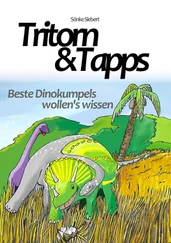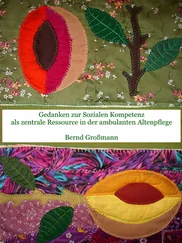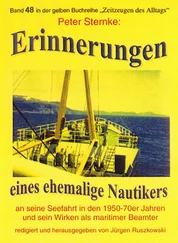2.5 Geduld in Studien
2.5.1 Rechercheziel
2.5.2 Schlagwörter
2.5.3 Recherchemethode der Studien
2.5.4 Resultate Forschungsfelder in Studien
2.5.5 Forschungsthemen der Studien
2.5.6 Zentrale Begriffe in Forschungsfeldern zur Geduld
2.5.7 Zusammenfassung: Geduld in Studien
3 Empirische Untersuchung Geduld als Ressource
3.1 Untersuchungsdesign
3.1.1 Wissenschaftstheoretischer Ansatz
3.1.2 Erkenntnisinteresse
3.2 Theoretischer Rahmen Forschungsinstrument: Qualitative Befragung
3.2.1 Datenerhebung und Stichprobenziehung theoretisch
3.2.2 Datenanalyse theoretisch
3.2.3 Methodische Begriffsklärungen einer qualitativen Inhaltsanalyse
3.3 Empirische Untersuchung
3.3.1 Forschungsethische Kriterien
3.3.2 Fragebogenaufbau
3.3.3 Umsetzung Datenerhebung und Stichprobenziehung
3.3.4 Umsetzung Datenanalyse
3.4 Auswertung und axiales Codieren ‚Befragung Geduld als Ressource‘
3.4.1 Auswertung ‚Überblick der Fragen‘
3.4.2 Auswertung ‚Kategoriensystem insgesamt‘
3.4.3 Auswertung ‚Selbsteinschätzung zur Geduld‘
3.4.4 Auswertung ‚Eigenschaften geduldiger Menschen‘
3.4.5 Auswertung ‚Definition zur Geduld‘
3.4.6 Auswertung ‚Wünsche für Vorhaben mit Geduld‘
3.4.7 Auswertung ‚Aktuelles Geduldserleben‘
3.4.8 Auswertung ‚Lernen von Geduld‘
3.4.9 Auswertung ‚Lernorte von Geduld‘
3.4.10 Auswertung ‚Vorbilder für Geduld‘
3.4.11 Auswertung ‚Gesundheitliche Gründe für Geduld‘
3.4.12 Auswertung ‚Gesundheitliche Hilfe von Geduld‘
3.4.13 Auswertung ‚Erfahrungen Situationen mit Geduld‘
3.4.14 Auswertung ‚Erfahrungen aus Situationen mit Geduld‘
3.4.15 Auswertung ‚Soziometrische Angaben‘
4 Diskussion
4.1 Interpretation der Untersuchung im Forschungskontext
4.1.1 Interpretation zum Phänomen der Geduld in der Forschung
4.1.2 Stellenwert der Geduld bei jungen Erwachsenen
4.2 Kriterien für Empfehlungen und Forschungsbedarfe
4.2.1 Forschungsbedarf insgesamt
4.2.2 Spezifischer Forschungsbedarf
4.3 Kritisches Hinterfragen der Ergebnisse
4.3.1 Evaluation der wissenschaftlichen Vorgehensweise
4.3.2 Passung der Methodenwahl
4.3.3 Befragung als geeignetes Instrument
5 Handlungsempfehlungen zur Geduld im Einzelcoaching
5.1 Geduld mit mir und anderen im wechselnden Kontext sehen
5.2 Gelassenheit und Ruhe am Beispiel von zuhörenden Vorbildern erfahren
5.3 Warten als Intervention des geduldigen Handelns in der Zeit verstehen
5.4 Konkrete, naheliegende Situationen zur Geduld besprechen
5.5 Gelegenheiten zur Reflexion von Stress und Entspannung ermöglichen
5.6 Motivierende Ziele für Herausforderungen formulieren
5.7 Geduld in Wahrung der Autonomie auch spirituell verstehen
6 Fazit und Ausblick
6.1 Orientierungspunkte für ein Fazit und Ausblick zur Geduld als Ressource
6.2 Geduld ein explorativer Auftrag aus der Burnout-Forschung
6.3 Geduld als geschichtliche Erfahrung persönlicher und gesellschaftlicher Krisen
6.4 Geduld als vernetzendes Wissen über Forschungsdisziplinen hinweg
6.5 Geduld eine übersehene Begegnung mit konkreten Problemlagen
6.6 Geduld eine Sichtweise junger Erwachsener
6.7 Geduld eine notwendige Diskussion in Praxis und Forschung
6.8 Geduld als Handlungsempfehlung für das Einzelcoaching
6.9 Sind ‚wir‘ bereit zur Geduld?
6.9.1 Verschiedenartigkeit in Familien und privaten Beziehungen
6.9.2 Bildungsdiskurse in Schule, Hochschule und Ausbildung
6.9.3 Arbeitswelt im schnellen Wandel
6.9.4 Geduld in der Corona-Krise 255
6.10 Ausblick
7 Literaturverzeichnis
Persönliche Angaben
Anhang
Anhang 1: Fragebogen Geduld als Ressource
Anhang 2: Auswertungstabellen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Der Forschungsprozess
Abbildung 2: Einleitung Grundbegriffe
Abbildung 3: Geduld im historischen Kontext
Abbildung 4: Forschungsansätze zur Geduld
Abbildung 5: Forschungsfelder
Abbildung 6: Alltagswissen/ wissenschaftliches Wissen nach Schaffer
Abbildung 7: Inhaltliche strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz
Abbildung 8: Kategorienraster
Abbildung 9: Kategorien der Geduld
Abbildung 10: Einstiegsfragen Geduld im Kontext
Abbildung 11: Geduld im beruflichen Kontext
Abbildung 12: Geduld im privaten Kontext
Abbildung 13: Geduld im Umfeld
Abbildung 14: Geduld in unterschiedlichen Kontexten
Abbildung 15: Geduld in der heutigen Zeit
Abbildung 16: Lernen von Geduld
Abbildung 17: Geduld als gesundheitliche Hilfe bei Veränderungen
Abbildung 18: Bin ich religiös?
Abbildung 19: Geschlecht
Abbildung 20: Geduld in sechs ethischen Kategorien
Abbildung 21: Geduldiges Handeln als Prozess209
Abbildung 22: Kategorien der Geduld
Abbildung 23: Themen der Befragung
Abbildung 24: Ressourcen der Geduld
Abbildung 25: Handlungsempfehlungen zur Geduld im Einzelcoaching
Tabelle 1: Themencluster der Studien zur Geduld
Tabelle 2: Handlungsverständnis zur Geduld
Abkürzungsverzeichnis
Anm. Anmerkungen
BDKJ Bund Deutscher Katholischer Jugend
BSB Bettina Siebert-Blaesing
bzw. beziehungsweise
DGSv Deutsche Gesellschaft für Coaching und Supervision e.V.
DGSF Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie
d.h. das heißt
EJA Erzbischöfliches Jugendamt
ebd. ebenda
et al. und andere
FSJ Freiwilliges Soziales Jahr
FSJler/ FSJlerin Freiwilliger im Sozialen Jahr/ Freiwillige im Sozialen Jahr
geb. geboren
ggf. gegebenenfalls
JE Junger Erwachsener/ Junge Erwachsene
kath. katholisch
SG Systemische Gesellschaft
sic so stand es geschrieben
SNS Synergetisches Navigationssystem
u.a. unter anderem
v.Chr./ n.Chr. vor Christi Geburt/ nach Christi Geburt
vgl. vergleiche
WHO Weltgesundheitsorganisation
z.B. zum Beispiel
Vorwort
„Geduld“ als innovativer Gegenstand sozialpädagogischer Coachingforschung – Prof. Dr. Bernd Birgmeier
Wenn sich Coaching – wie es aktuelle Tendenzen in Aussicht stellen – weiterhin im Aufwärtstrend befindet und viele namhafte Experten dieser Beratungs-, Unterstützungs- und Begleitungsform vielfältige positive Entwicklungschancen bescheinigen, wird es in Zukunft nicht nur als personenbezogene Dienstleistung für (Sozial-)Manager und Führungskräfte aus öffentlichen und privaten Trägern der Sozialen Dienste immer interessanter werden, sondern v.a. auch für unterschiedlichste Adressat*innengruppen der Sozialpädagogik. Denn gerade für jene, die erschwerte Lebens- und individuelle Problemlagen zu meistern haben, könnte ein sozialpädagogisches Coaching eine zusätzliche, spezifische Hilfe (zur Selbsthilfe) bedeuten, mit der soziale Benachteiligungen abgebaut und persönliche Entwicklung und Lebensbewältigungskompetenzen gefördert werden könnten.
Die persönlichkeitszentrierte Entwicklung des Subjekts und die Arbeit an der Sinnfindung und Sinngebung für einen gelingenden Lebensentwurf ist somit nicht nur das Kernthema verschiedenster Ansätze humanistisch geprägter sozialpädagogischer Beratung, sondern ebenso das eines sozialpädagogischen Coachings. Dieses versteht sich als eine spezifische Teilform professioneller Beratung, Beziehung, Begegnung, Bildung, Betreuung und Begleitung von Menschen unterschiedlichster Lebensalter. Dabei hat sich das sozialpädagogische Coaching als Medium der Gestaltung und Bewältigung von Lebensaufgaben jedoch erst noch konzeptionell, (meta-)modelltheoretisch und ethisch zu begründen, empirisch zu belegen sowie wissenschaftlich abzusichern, um sich tatsächlich auch als innovative Form professionellen, methodischen Handelns in der Sozialpädagogik ausweisen zu können.
Читать дальше