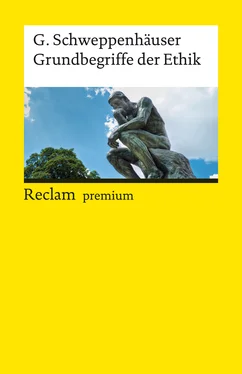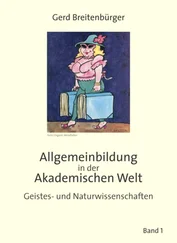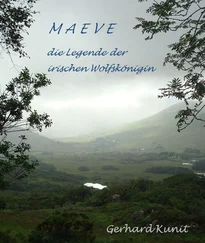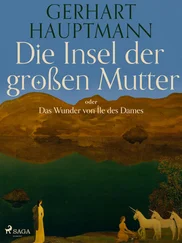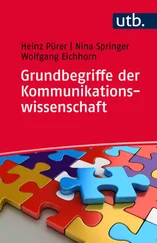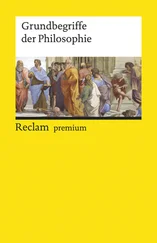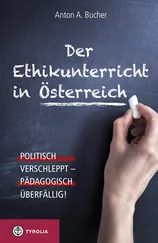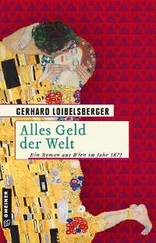Das Werte-Lamento ist offenbar auch unvermeidlich, wenn sich eine neue Jugendkultur durchsetzt: Gesellschaftliche Phänomene, die traditionell negativ beurteilt werden – z. B. Egoismus, Verweigerungshaltung und Konkurrenzmentalität oder Konsumismus, exzessiver Gebrauch neuer Medien und eine als hemmungslos empfundene Selbstbezogenheit –, werden dann gern auf den Verlust [29]verbindlicher Werte zurückgeführt. Dabei wird übersehen (oder verleugnet), dass es sich bei jenen Phänomenen nie um ein gänzliches Fehlen von Werten und Bewertungsweisen handelt, sondern lediglich um Umwertungen, die meist nicht bewusst reflektiert werden (Hilgers 2002). Der Pazifismus der Hippies in den 1960er Jahren wurde hierzulande mit Klagen über den Verfall der Werte kommentiert, und ganz ähnlich waren die Reaktionen auf den rassistischen Terror rechtsradikaler Jugendlicher seit den 1990er Jahren. Nun sind aber nicht nur love and peace , Toleranz und Multikulturalität Werte, sondern eben auch imaginierte nationale Identitäten, Rassenhygiene, ethnische Sauberkeit und heilige Kriegsziele – so unerfreulich das auch ist, wenn man diese Werte von einem modernen, aufgeklärten Standpunkt aus betrachtet. In der Gegenwart kehren sie als Orientierungsgrößen zurück, die zunehmend auch von jungen, völkisch gesinnten Menschen geschätzt werden, weil sich im Rekurs darauf ein regressiver Hass gegen Menschen mit anderer Herkunft, anderen Lebensgewohnheiten und anderen sexuellen Orientierungen rationalisieren lässt.
Was manchen Beobachter*innen zunächst als eine Spielart der Jugendkultur erscheinen mochte, wuchs rasch zu einer ganz neuen Gestalt der öffentlichen Kommunikation an: die Netzkultur des digitalen Zeitalters. Kein Wunder, dass auch auf diesem weiten Feld die Klage über Werteverfall laut wurde. Hier geht es vor allem um gewandelte Formen des Umgangs miteinander und der Wertschätzung anderer. Allgemein wird der Verlust von Respekt und Anstand angeprangert. Durch die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit digitalen Endgeräten und Internetzugängen hat sich eine Social-Media-Öffentlichkeit [30]konstituiert, die in immer größerem Ausmaß auf journalistische Professionalität verzichtet. Kommentator*innen und Welterklärer*innen bilden ihre eigenen Formen der Mitteilung aus. Dabei haben sich die Phänomene des shitstorms , der hate speech und der cancel culture in den Vordergrund gedrängt. Sie scheinen dem Muster des Aufbegehrens von Schülern zu folgen, deren Tyrannen sich zurückziehen. Menschen mit Gewaltphantasien schreiben sich in den social media warm, wo sie kaum von gatekeepers behelligt werden. Der marktradikale Umbau der Medienlandschaft hatte ihre Kontrollinstanzen geschwächt. Dass sie in postmodernen Diskursen als altmodisch und moralisch-belehrend delegitimiert wurden, kam hinzu. Kurzatmiges Aufbegehren kann sich in diesem Klima als radikale Kritik gerieren (und sich selbst als solche missverstehen). Wozu soll man sich beispielsweise die Mühe machen und Kants Schriften studieren, wenn man doch kurzerhand darauf hinweisen kann, dass er sich in seiner Anthropologie nicht von den rassistischen Auffassungen seiner Zeit frei machen konnte? Bedauerlicherweise entgeht solch einer Lektüreverweigerung, dass derselbe Kant in seiner Moralphilosophie entscheidende Argumente formuliert hat, ohne die eine radikale Kritik des Rassismus theorielos und willkürlich bleiben würde (siehe dazu Brumlik 2020).
Die Vereinigung »Werte Leben« beklagte 2020, dass immer mehr »beleidigende Kommentare«, »feindselige Kommentare oder Posts« in den sozialen Netzwerken auftauchen, die einzelne Personen herabsetzen, und »Hassreden […] ganze Menschengruppen ins Visier« nähmen, »um diese gezielt herabzuwürdigen« (Werte Leben Online 2020). Gegen kommunikative »digitale Gewalt« gibt die [31]Vereinigung pädagogische Ratschläge, die auf eine Haltung der Toleranz, des Respekts und der Bereitschaft zur Aufklärung abzielen. Sie empfiehlt jungen Nutzer*innen der sozialen Netzwerke, ruhig zu bleiben, wenn sie angegriffen werden, und nicht durch aufgebrachte Reaktionen zur Eskalation beizutragen. Sie empfiehlt des Weiteren, »Hater« zu blockieren sowie Eltern, Lehrer*innen und Vertrauenspersonen um Hilfe zu bitten. Zur allgemeinen Bekämpfung des Phänomens wird empfohlen, Hasskommentare nicht zu »liken« oder zu »teilen«, sich nicht unbedacht beeinflussen zu lassen, sondern zu seiner eigenen Meinung zu stehen, diese kundzutun und andere Nutzer*innen aufzuklären: »Wir bei WERTE LEBEN – ONLINE machen uns stark für mehr Respekt und Mitgefühl im Netz. Auch Du kannst mit uns zusammen Dein Zeichen gegen Hass im Netz setzen.« (Ebd.)
So richtig und wichtig die pädagogische Ermahnung ist: Es steht zu befürchten, dass ihre Wirkung begrenzt bleiben wird, zumal dann, wenn es um Erwachsene geht. Menschen, die irre Kommentare im Internet schreiben, auf den Straßen »Lügenpresse« brüllen, Politiker*innen beleidigen oder mit dem Tode bedrohen und vor laufenden Kameras Fernsehreporter verprügeln, tun das nicht, weil ihnen noch niemand erklärt hat, wie unanständig so etwas ist. Ihr kommunikatives Handeln und Misshandeln ist vermutlich kein Ausdruck der Gleichgültigkeit gegenüber jedweden Werten, vielmehr einer eigenen Wertorientierung. Was für sie von hohem Wert ist und zuvor aus Furcht vor Sanktionen nicht an die Öffentlichkeit gelangte, das kann heute die Runde machen – unbehelligt von Redakteur*innen, die man andernorts dafür bezahlt, zu verhindern, dass [32]repressive und destruktive Gewaltphantasien verbreitet werden. Zeitweise wird diese ehemalige Nischenkultur des autoritätsgebundenen Charakters in deutschen Länderparlamenten adäquat repräsentiert.
Um derartige Zusammenhänge in ihrer Komplexität zu beschreiben und über ihre Wirkmechanismen aufzuklären, reicht ethische Reflexion allein nicht aus. Sie muss sich mit sozialpsychologischen und (bei diesem Beispiel jedenfalls) mit mediensoziologischen Überlegungen verbinden.
Die privatwirtschaftlich basierte Netzkultur des digitalen Zeitalters greift eine ehedem wichtige Instanz des Zirkulationssektors an, die durch die Digitalisierung von Produktions- und Zirkulationssphäre geschwächt ist. Dabei tritt zweierlei zutage:
1 dass die Macht der Presse im Schwinden begriffen ist, weil Zeitungen tendenziell überflüssig werden, wenn Informationswaren auf dem neuesten Stand der Technik über neue Distributionsmedien vermarktet werden, und
2 dass das erzieherische polit-kulturelle Bollwerk des öffentlich-rechtlichen Rundfunks immer verzichtbarer erscheint. Meinungen triumphieren über Wahrheit und Erkenntnis, Identität triumphiert über Differenz und Differenzierung. Die Wertverschiebungen an der gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Basis führen zu Veränderungen der Wertorientierung in der sozialen Kommunikation.
Die Tendenz ist indessen auch von entgegenwirkenden Faktoren begleitet. Nach dem Ausbruch der SARS-CoV-2-Pandemie konnten die öffentlich-rechtlichen [33]Informationsmedien hierzulande beim Publikum wieder aufholen. Ob sie damit das Terrain zurückgewinnen, das sie an kommerzielle Kanäle und an die chaotischen (Des-)Informationssphären sozialer Netzwerke verloren hatten, steht noch dahin. Allerdings war es nicht erst die Nachfrage nach allgemeinverständlichen Darstellungen aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und nach Widerlegung von Verschwörungsnarrativen, die ein vitales Interesse an methodisch kontrolliert gewonnenem Wissen hervorgebracht haben. Dieses zeigte sich bereits in der Massen-Jugendbewegung »Fridays for Future«, dem Protest gegen die destruktiven Folgen industriekapitalistischer Naturausbeutung.
Werte sind Gegenstand von Kontroversen. Für viele Menschen schien nach dem 11. September 2001 deutlich geworden zu sein, dass nicht nur Frieden einen Wert darstellt, sondern ebenso Freiheit und die Kraft, sich gegen Angreifer zu verteidigen, die bereit sind, Menschenleben einzeln und in Massen für ihre Werte zu opfern. Die Bundesrepublik befindet sich seit 2015 laut offizieller Sprachregelung in einem »Kampf« gegen den IS und sein Kalifat. »Deutsche Soldaten sind auch künftig im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat im Einsatz. Der Auftrag der Bundeswehr wird ausgeweitet«, teilte das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung im November 2016 mit (Bundesregierung 2016). Die religiös-faschistischen Herrscherfiguren des IS wollen durch kriegerische Aktivität nach außen ihren Herrschaftsbereich im Innern absichern. Der Kampf [34]dagegen wird »von einer breiten internationalen Koalition getragen, der Deutschland seit Anfang 2015 angehört« (ebd.), so die Internetseite der Bundesregierung. Dass Deutschland seit seinem Eintritt in den »Kampf«, den man auch als Krieg bezeichnen kann, Zielscheibe derjenigen Kampfmittel ist, welche die asymmetrischen Kriege der Gegenwart kennzeichnen, ist insofern folgerichtig. Niemand hört es gern, wenn etwa die Opfer des Terroranschlags am Breitscheidplatz in Berlin im Dezember 2016 als Opfer eines weltweiten Krieges der nordatlantischen Wertegemeinschaft verbucht werden, doch spricht einiges für diese These.
Читать дальше