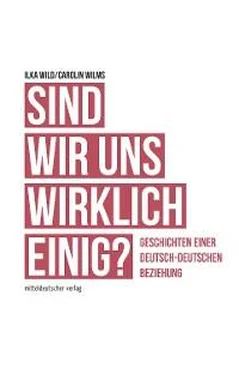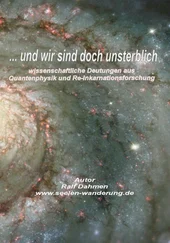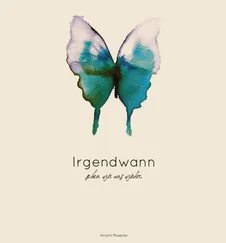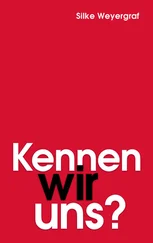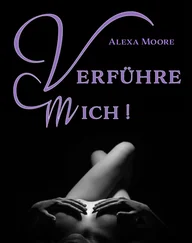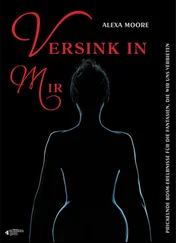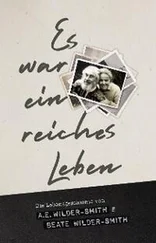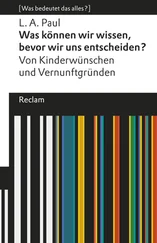Es lese sich wie eine Abrechnung, schrieb ein Leser der Leipziger Volkszeitung in einem Leserbrief zu diesem Buch, ohne Optionen aufzuzeigen, wie ein Miteinander gelingen könne. Ein anderer nannte es gar eine primitiv und diskriminierend formulierte Lektüre.
Anders als über die berufssächsische Verfasserin habe ich im Podcast der Wochenzeitung Die Zeit vom 14. Februar 2019 in einem Gespräch mit der Leipziger Autorin und Journalistin Jana Hensel gestaunt, als sie auf die Frage, was sie beruflich gemacht hätte, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, antwortete, dass sie genau dasselbe machen würde wie heute. Dass kritische Berichterstattung in der gleichgeschalteten DDR-Staats-propaganda nicht möglich war und zu Berufsverboten und Zuchthausstrafen geführt hat, ist bekannt. Eine solche Aussage verklärt die Situation, in der sich Andersdenkende in der DDR befunden haben.
Und wieder frage ich mich, wie das weitergehen soll? Die eine peitscht auf, die andere spielt die mangelnde Meinungsfreiheit in der DDR runter.
Bei allen Ungerechtigkeiten, die die Kommission zur Aufarbeitung der Tätigkeit der Treuhand aufdecken soll, darf nicht aus dem Blick verloren werden, was alles erreicht wurde.
Für beide Teile Deutschlands war es die erste Wiedervereinigung, beim nächsten Mal wäre man schlauer, könnte einer einwenden, aber Gift entsteht erst durch seine Dosis: Daher wäre es für das Zusammenwachsen wichtig – allen Befindlichkeiten zum Trotz – das Positive zu sehen, was bisher erreicht wurde und den Blick nach vorn zu richten. Welches andere Land hat in diesem Hinblick etwas Vergleichbares vorzuweisen? Dieser Prozess war und ist nicht ohne Schwierigkeiten und Rückschläge möglich. Wenn sich die Menschen eher auf das Verbindende als auf das Trennende konzentrieren und nicht mit „Besatzer“-Begriffen die Glut schüren, wird das Gemeinsame in den Vordergrund gerückt.
Während früher die Unterschiede zwischen Bayern und Hamburg mit zahl- und achtlosen Witzen bedacht wurden, wird heute gern auf den Klischees des Ostens rumgeritten: Alle Ossis sind arbeitslos und rechts. Der Gag-Schreiber ist mit diesen Themen auf der sicheren Seite, die Lacher sind garantiert. Aber der Vergleich zu den alten BRD-Witzen hinkt.
Als ich in Nürnberg studierte, fragte mich mein oberbayrischer WG-Bewohner, wie das eigentlich sein könne, dass ich als Bremer Nutznießerin des Länderfinanzausgleichs, überhaupt ein Stimmrecht bei der Bundestagswahl haben könne. Wie sich zeigte, hatte nicht nur ich den Eindruck, dass er dämlich war, denn er fiel durch seine letzte Prüfung, aber befremdlich fand ich diese Denke schon. Der Spruch „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ mag vielleicht in einigen Familien funktionieren, innerhalb eines Landes aber sicher nicht. Den Ostdeutschen vorzuhalten, dass man so viel Geld in ihre Bundesländer gepumpt hat und sie mit ihren neuen Bürgersteigen endlich zufrieden und dankbar sein sollen, ist nicht nur unsensibel, sondern nicht zielführend. Wie bei Montessori ist Hilfe zur Selbsthilfe, eins der besten Konzepte überhaupt. Der Aufbau Ost war eine Selbstertüchtigung und sollte keine endlose Alimentierung werden. Die finanzielle Unterstützung läuft bald aus und das ist auch gut so. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle kam im März 2019 in seiner Studie „Vereintes Land – drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall“ etwa zu dem Schluss, dass die Produktivität des Ostens, der im Westen um 20 Prozent nachhängt, und zwar deswegen, weil der Arbeitsplatzerhalt staatlich subventioniert ist.
Und die Studie der Bertelsmann Stiftung „Monitor Nachhaltige Kommune“ aus dem Jahr 2018 ergab, dass die Armutsquote in Ludwigshafen und im Ruhrgebiet zugenommen, dafür aber in Städten wie Erfurt, Chemnitz und Rostock merklich abgenommen hat. Vielleicht verschiebt sich die Fokussierung für Wirtschafts- und Sozialhilfe nun auf diese Regionen im Westen und der Osten kann jetzt, auf eigenen Füßen stehend, den Westen unterstützen. Dann hören Neid, Bezichtigungen und Unterstellungen vielleicht von ganz allein auf und „Schnauze“-Bücher haben ausgedient.
Wo geht die Reise hin?
Von Ilka Wild
Ich habe große Teile meines Studiums auf Taiwan verbracht und dort einige Jahre gearbeitet. Die Insel im südchinesischen Meer nennt sich offiziell „Republik China“ und ist der Gegenentwurf zum großen kommunistischen Festland. Hier herrscht offiziell Marktwirtschaft, die kommunistische Propaganda ist weit weg. Durch die Seestraße von Taiwan geht noch immer eine Trennlinie, ähnlich wie eine solche durch die beiden deutschen Staaten ging. Das wird, je nach politischer Ausrichtung, von Taiwanern verflucht oder begrüßt. Sollte es jemals zu einer faktischen Wiedervereinigung kommen (offiziell gibt es keine zwei chinesischen Staaten, nur zwei unterschiedliche Interpretationen davon), wird das überlegene System eines sein, das sich selbst kommunistisch nennt. Für die Taiwaner heute ist das ein nicht ganz unwahrscheinliches Szenario.
1989 wäre ein solcher Ausgang für das vereinte Deutschland undenkbar gewesen. Ich stelle mir vor, wir hätten die Möglichkeit des Siegs des Kommunismus über ganz Deutschland 1989 einmal diskutiert: Kaum ein Ostdeutscher hätte das für realistisch oder gar erstrebenswert gehalten. Hätte es so viele Anhänger des alten Systems im Osten Deutschlands gegeben, wie es in manchen Diskussionsrunden heute scheint, hätte es im Osten einen Bürgerkrieg gegeben und keine Friedliche Revolution. Der Konsens unter den damaligen DDR-Bürgern, dass das alte System wegmusste, war so groß, dass es glücklicherweise ohne große Gegenwehr in sich zusammenfiel.
Das SED-Regime hatte nicht nur das Land heruntergewirtschaftet, es hatte seine Bürger systematisch überwacht und bevormundet – das waren die eigentlichen Gründe für den System-Kollaps. Auch wenn es in den Monaten, die auf den Mauerfall folgten, anders erschien: Die DDR-Bürger kämpften nicht dafür, Bananen einkaufen zu können oder Levis-Jeans, sie gingen für Bürger- und Menschenrechte auf die Straße. Gingen das Risiko ein, von der Stasi in Visier genommen zu werden oder im Betrieb Ärger zu bekommen, falls sie beim Demonstrieren gesehen wurden.
Man hat sich die Freiheit und das neue System mehr oder weniger hart erkämpft. Die Friedliche Revolution von 1989 ist eine Leistung, die man würdigen muss – in Ost und West. Das geschieht, meiner Meinung nach, heute viel zu wenig. Die erkämpften Rechte nimmt man gern als selbstverständlich hin. Ich glaube, dass viele es verschmerzen könnten, wenn es von heute auf morgen keine Bananen mehr zu kaufen gäbe. Aber ich stelle mir den Aufschrei vor, wenn man von heute auf morgen seine fünf neuen Bundesländer nicht mehr verlassen dürfte. Und einen Antrag stellen müsste, um nach Polen in den Urlaub zu fahren. Dass man Übernachtungsgäste in der eigenen Wohnung in ein Hausbuch bei einem ‚Hausvertrauensmann‘ eintragen müsste. Oder wenn die Kinder nicht studieren dürften, weil diese oder man selbst nicht in eine bestimmte Partei eintreten will. All diese Erniedrigungen waren Normalität in einem Unrechtsstaat, der von manchen heute verklärt wird.
Diese neuen Rechte und Freiheiten haben natürlich eine Kehrseite. So wie sich die Ostdeutschen ein Westdeutschland vorstellten, wie sie es aus dem Westfernsehen kannten, und wie sie sich dementsprechend das vereinte Deutschland gewünscht hatten, wurde es meist nicht. Besonders in den ersten Jahren gingen viele wirtschaftlich durch ein Tal der Tränen. Und einige haben den Systemwechsel, materiell gesehen, nie für sich nutzen können. Besonders tragisch ist das für diejenigen, denen es ohne eigene Schuld nie gelungen ist, nach der Wende wirtschaftlich auf die Füße zu kommen: Wenn man im Osten einen Beruf gelernt hatte, der von heute auf morgen nicht mehr gebraucht wurde oder wenn ganze Industrielandschaften plötzlich brach lagen – wie sollte es dann weitergehen, besonders für Leute, die den Großteil ihres Berufslebens schon hinter sich hatten. Sollten nun alle den Arbeitsplätzen hinterherziehen und den Osten verlassen? Von den 14.000 DDR-Betrieben unter Treuhand-Verwaltung wurden 4.000 geschlossen, Hunderttausende Jobs im Osten gingen verloren.
Читать дальше