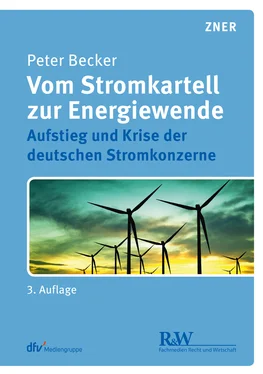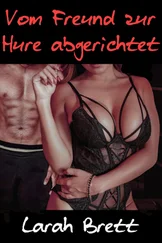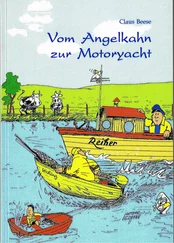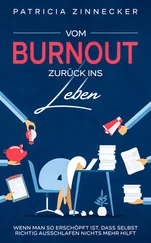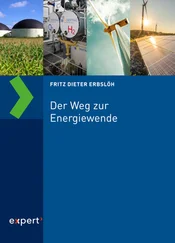Diese Entscheidung war auch deswegen bedeutsam, weil das OLG Düsseldorf dasjenige Gericht ist, bei dem Beschwerden gegen Entscheidungen des Bundeskartellamts landen. Das Bundeskartellamt hätte also, wäre es gegen langfristige Gaslieferverträge vorgegangen, sicher sein können, dass es beim OLG Düsseldorf gewinnt. Außerdem war bekannt geworden, dass auch das OLG Stuttgart der – späteren – Rechtsauffassung des OLG Düsseldorf zuneigte. Schon in einem Berufungsverfahren in einem Stromfall hatte das OLG Stuttgart nämlich zu erkennen gegeben, dass es die in einem Altvertrag vereinbarte Gesamtbedarfsdeckungsverpflichtung eines Weiterverteilers als Verstoß gegen § 1 GWB betrachtete.100 Auch in einem Gas-Fall, angepackt von dem tatkräftigen Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall, Johannes van Bergen, beurteilte das OLG Stuttgart die Rechtsfrage im kommunalen Sinne.101 Im Revisionsverfahren vor dem BGH ließ dieser deutlich erkennen, dass auch er die Position der Stadtwerke und die Argumente ihrer Anwälte für richtig hielt. Außerdem argumentierte auch das Bundeskartellamt vor dem BGH im Sinne der Stadtwerke. Aber es kam zu keinem Urteil: Auf Betreiben der Ruhrgas, die wieder einmal das Füllhorn ausgeschüttet haben soll, wurde die Revision der Stadtwerke zurückgenommen. Eine Leitentscheidung des Bundesgerichtshofs war damit verhindert.
Obwohl das Bundeskartellamt für eine nunmehr bundesweite Beanstandung der langfristigen Verträge sicheren Boden unter den Füßen gehabt hätte, rührte es sich nicht. Stadtwerke, die den Versorger wechseln und am Wettbewerb teilnehmen wollten, waren also nach wie vor auf eigenes Risiko unterwegs. Aktiv wurde das Amt erst mit einem Auskunftsersuchen vom 1.12.2003, mit dem es die Vertragsverhältnisse der in Deutschland tätigen 15 überregionalen und regionalen Ferngasunternehmen auf den Weiterverteilermärkten untersuchte. Und dann dauerte es weitere zwei Jahre, bis am 13.1.2006102 eine Verfügung gegen die Ruhrgas erging, mit der das Amt feststellte, dass verschiedene Gaslieferverträge der Ruhrgas hinsichtlich langjähriger Bezugsverpflichtungen und tatsächlicher Bedarfsdeckungen in ihrer Kombination gegen Art. 81, 82 EG und § 1 GWB verstießen. Die Ruhrgas wurde verpflichtet, die Durchführung solcher Verträge bis spätestens zum 30.9.2006 abzustellen – eine äußerst großzügige Übergangsfrist. Ferner wurde festgelegt, dass die Ruhrgas bei Verträgen mit einer Liefermenge von mehr als 200 GWh pro Jahr die Laufzeit nicht länger als vier Jahre festlegen dürfe, wenn der Bedarf des Abnehmers zwischen 50 bis 80 % liege, und nicht mehr als zwei Jahre, wenn der Bedarf 80 % überschreite. Klar: Die Ruhrgas klagte gegen diese Verfügung vor dem OLG Düsseldorf. Und sie verlor103; und genauso beim BGH.104 Damit waren die Verhältnisse geklärt – und die Ruhrgas konnte nicht mehr, wie bisher, die anderen Wettbewerber an die Wand drücken.
Aber was passierte: Das Bundeskartellamt erklärte knapp zwei Jahre später, auf eine Befragung von über hundert Marktteilnehmern verweisend – darunter große Gasgesellschaften, ausgewählte Wettbewerber und Kommunal- und Regionalversorger –, die Ruhrgas dürfe nun wieder Stadtwerke und Regionalversorger beliebig lange und intensiv an sich binden.105 Handlungsbedarf hatte bestanden, weil die Bindungswirkung der Verfügung, die bis zum 30.9.2010 befristet war, nicht verlängert werden sollte. Zugleich aber prangerte der neue Kartellamts-Präsident Mundt, nach der Regierungsübernahme von Schwarz-Gelb ins Amt gekommen, die „ extreme Sozialschädlichkeit von Kartellen “ an.106 Der Beobachter wundert sich, die Wettbewerber der Ruhrgas ärgern sich, aber beim Amt herrscht offenbar die Erwartung, dass Ruhrgas in den vergangenen zwei Jahren den Wettbewerb geübt habe und auf den Geschmack gekommen sei ...
6. Netznutzung: Viel Bürokratie und wenig Wettbewerb
Eigentlich hatte der Wettbewerb beim Strom so schön angefangen: Nicht nur Yello, VASA, ENRON, Zeus, Riva, Best Energy traten an. Vielmehr gründeten auch E.ON mit der Marke E-WIE-EINFACH und RWE mit der Marke Eprimo Töchter zur Belieferung vor allem von Haushalts- und kleinen Gewerbekunden. Aber die Mehrzahl der Newcomer verschwand sehr schnell wieder vom Markt. Die Gründe waren mit Händen zu greifen:
– Der Netzzugang musste in vielen Fällen erst vor Gericht erstritten werden107;
– wegen der fehlenden Rechtsverordnung über die Gestaltung der Netznutzungsverträge gemäß § 6 Abs. 2 EnWG konnte jeder Netzbetreiber die einschlägigen Verträge autonom gestalten, was die Händler wiederum zwang, in monatelangen Verhandlungen Verträge für oft nur wenige Kunden auszuhandeln;
– oft wurden auf Basis des sogenannten „Doppelvertragsmodells“ Verträge des Netzbetreibers sowohl mit den neuen Lieferanten als auch mit den Endkunden verlangt;
– verlangt wurden auch Wechselentgelte, also Entgelte für das Handling des Versorgerwechsels;
– Kritikwürdig waren aber vor allem die Netznutzungsentgelte, die Spreizungen von bis zu 300 % aufwiesen und insgesamt überhöht waren, obwohl sie angeblich alle auf dem Kalkulationsleitfaden zur Verbändevereinbarung VV II und VV II plus basierten.
Die FAZ vom 27.4.2001 titelte in einem Bericht über die Newcomer: „ Wir werden von den Versorgern schikaniert .“ Yello-Geschäftsführer Zerr108 behauptete: „ Die Regierung schützt die Monopole .“ Selbst EnBW-Chef Goll bemängelte die Verbändevereinbarung und verlangte ein verbindliches Regelwerk und eine staatliche Regulierungsinstanz.109
Dazu noch folgendes Schmankerl: Beim Bundeswirtschaftsministerium war zur Beschwichtigung der Kritik eine „ task force Netzentgelte “ eingerichtet worden; Leiter: Der vormalige Vorsitzende der 8. Beschlussabteilung beim Bundeskartellamt Schultz. Wie jedoch der Focus am 5.8.2001 meldete, waren allein drei Mitglieder der task force von großen Energieversorgern ausgeliehen und würden weiterhin von den Unternehmen bezahlt. Das Wirtschaftsministerium begründete diese Organisation der Aushilfe damit, dass die Haushaltslage nur wenige neue Ministeriumsstellen zulasse.
Die Kartellbehörden bemühten sich redlich110, die Missstände abzustellen. Mit ihrem System der Ex post-Kontrolle musste aber jeder Einzelfall aufgegriffen werden. Der Angriff auf die Kalkulationsgrundsätze der Verbändevereinbarung111 scheiterte vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf.112 Das OLG meinte, das Bundeskartellamt sei im Rahmen der Missbrauchsaufsicht nicht befugt, irgendeine Kalkulationsmethode vorzuschreiben. Die Preisfindungsprinzipien der VV II plus seien ein „ taugliches und betriebswirtschaftlich vertretbares Konzept zur Preiskalkulation “. Im juristischen Schrifttum wurden daher seit dem Jahre 2001113 die Effekte des verhandelten Netzzugangs kritisch beleuchtet und eine Regulierung gefordert.
7. Das erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts
Trotz dieser Kritik hielt die Koalition mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 9.5.2001114 am branchenfreundlichen Kurs fest. Es ging dort zunächst nur um die Umsetzung eines Anstoßes aus Brüssel, nämlich die Aufnahme der Gasrichtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.6.1998. Jedoch reichten die Fraktionen SPD und Bündnis90/Die GRÜNEN im Mai 2002 einen Änderungsantrag ein, wonach in § 6 Abs. 1 eingefügt werden sollte, dass „ bei Einhaltung der Verbändevereinbarung über Kriterien zur Bestimmung von Netznutzungsentgelten für elektrische Energie und über Prinzipien der Netznutzung ... bis zum 31. Dezember 2003 die Erfüllung der Bedingung guter fachlicher Praxis vermutet “ werde. Federführer: Der energiepolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Volker Jung, zugleich Beigeordneter beim VkU, der 1997 noch gegen eine Verbändevereinbarung gewesen war.
Читать дальше