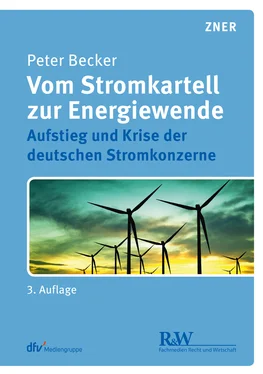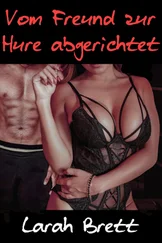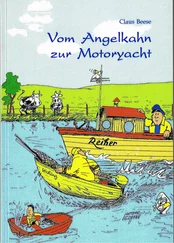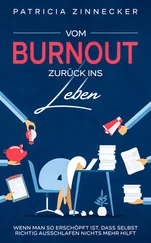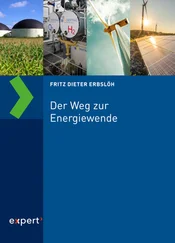Im Spätsommer 1991 fragte ich den wissenschaftlichen Mitarbeiter von Prof. Böckenförde, ob und wann es zu einer mündlichen Verhandlung komme. Für den Fall einer mündlichen Verhandlung regte ich an, diese in den neuen Ländern durchzuführen: Rechtsstaat und Rechtsprechung seien für die ostdeutschen Bürger und ihre Kommunen generell etwas Neues. Die Rolle und die Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts seien ihnen nicht vertraut. Das spreche für einen auswärtigen Termin des Bundesverfassungsgerichts in den neuen Ländern – wohl den ersten in seiner Geschichte. Einige Tage später berichtete Geschäftsführer Horstmann von den Stendaler Stadtwerken, das Bundesverfassungsgericht habe bei ihm angefragt, wo man in Stendal eine solche Verhandlung durchführen könne. Er habe das Reichsbahnausbesserungswerk angeboten. In der Tat wollte das Verfassungsgericht dort verhandeln. Wieder einige Tage später ging die Ladung zur mündlichen Verhandlung in Stendal am 27.10.1992 ein. Beigefügt war eine Liste mit Fragen des Bundesverfassungsgerichts. Aus einer Veröffentlichung von Harms64 hatte das Verfassungsgericht entnommen, dass die Vermögensanteile für die örtliche und die regionale Stromversorgung zwar in den einzelnen Bezirks-EVU je nach Lage unterschiedlich, im Durchschnitt aber hälftig der kommunalen und hälftig der regionalen Versorgung zuzuordnen seien. Dem entspreche ja die etwa hälftige Aufteilung der Kapitalbeteiligungen an den Bezirks-EVU nach der angegriffenen Maßgaberegelung zu § 4 Abs. 2 KVG. In der Vorbereitung zur mündlichen Verhandlung mit dem VKU kam deswegen die Idee auf, dass das Verfassungsgericht möglicherweise einen Vergleich vorschlagen werde. Zur Vorbereitung gehörte auch eine Umfrage bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern unserer Beschwerdeführerinnen, wer an der mündlichen Verhandlung teilnehmen wolle. Wir organisierten die Wortmeldungen und die Pressearbeit. Es sollte nichts dem Zufall überlassen werden.
Die mündliche Verhandlung erwarteten wir mit größter Spannung. Zu den Vorbereitungen gehörte mit der Amtstracht des Anwalts, der schwarzen Robe, auch eine weiße Fliege. Diese hatte sich beim Binden am Morgen in ihre Bestandteile aufgelöst. Aber an der Garderobe des Reichsbahnausbesserungswerks hatten die Garderobefrauen in ihren weißen Kitteln selbstverständlich Nadel und Faden dabei, so dass das Missgeschick schnell behoben war. Im Saal mit seinen verräucherten schweren Vorhängen roch es wie überall in den Amtsstuben der neuen Ländern nach Desinfektionsmitteln. In einem kleinen Raum hinter dem Richtertisch, der auf einem frisch zusammengezimmerten Podest aufgestellt war, gingen wir den Ablauf der Verhandlung durch. Auf unserer Seite stritten noch mit der Prozessvertreter von 17 Thüringer Kommunen, Prof. von Mutius/Kiel, Prof. Rupp für die Stadt Forst und Prof. Wieland als Gutachter im Auftrag der SPD-Bundestagsfraktion. Dabei war auch Dr. Weigt, Justitiar des VKU, der die juristische und mentale Unterstützung des VKU beisteuerte.
In der mündlichen Verhandlung ging der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts unter Vorsitz von Prof. Böckenförde – Prof. Mahrenholz, eigentlich Senatspräsident, war erkrankt – mit uns den Prozessstoff durch. Böckenförde war bestens vorbereitet. Wohin die Reise ging, war zunächst nicht auszumachen. Kurz vor der Mittagspause stellte Prof. Kirchhof einige unangenehme Fragen nach dem bisherigen und herrschenden Verständnis der kommunalen Daseinsvorsorge des Art. 28 Abs. 2 GG als institutionelle Garantie. Daraus war ein Anspruch auf Chancengleichheit mit den westdeutschen Kommunen und auf eine Art Grundausstattung nur schwer ableitbar. Mit hängenden Ohren ging es in die Mittagspause, die mit einer Pressekonferenz begann, die Dr. Gramlich, OB von Potsdam, eröffnete. Wir bemühten uns, Optimismus zu verbreiten. Am Nachmittag kamen eindrückliche Plädoyers unserer kommunalen Vertreter, unter denen das von Bürgermeister Hohberg aus der kleinen Thüringer Gemeinde Sollstedt besonders herausragte; er beschwor mit flammenden Worten die Entrechtung der Kommunen zunächst durch die sozialistische DDR, an die sich die durch die Stromverträge und ihre Flankierung durch die Bundesregierung anschloss. Das machte Eindruck. Herr Horstmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Stendal, berichtete äußerst farbig über den erfolgreichen Aufbau seiner – und vieler anderer – Stadtwerke, der das Misstrauen der Grundsatzverständigung, die jedem Stadtwerk eine Zwangsbeteiligung von westdeutschen EVU verpassen wollte, in keiner Weise rechtfertigte. Ich machte darauf aufmerksam, dass die westdeutschen EVU in ihrem Verhältnis zu den Stadtwerksgründungen sehr unterschiedlich aufgetreten seien und lobte das Bayernwerk, dessen Vorstandsvorsitzender, wie ich wusste, aus dem Bayerischen Wirtschaftsministerium kam und offenbar Verständnis für die Wünsche der Kommunen hatte. Er hatte nämlich den Stadtwerken in Thüringen in großem Umfang Hilfe bei den Vorkehrungen für die Betriebsaufnahmegenehmigung nach § 5 Energiewirtschaftsgesetz zugesichert und auch geleistet.
Kurz vor 17 Uhr gab Prof. Böckenförde bekannt, dass sich der Senat zu einer Zwischenberatung zurückziehen wolle. Zurückgekehrt machte er – für die meisten Zuhörer völlig überraschend, aber nicht für uns – einen Vergleichsvorschlag: Die Lage in den neuen Ländern sei doch nicht anders als bei Auslaufen eines Konzessionsvertrags. Die Kommunen hätten aus ihrem Wegerecht den Anspruch auf Übertragung der Versorgungsanlagen. Als Kaufpreis könnten sie den Wert ihrer Kapitalbeteiligungen einsetzen. Während dieser Worte drehte ich mich um zu Dr. Weigt vom VKU, der hinter mir saß. Er strahlte. Wir hörten uns den offensichtlich schriftlich vorbereiteten Vergleichsvorschlag des Gerichts an und kehrten nach einer Pause mit den „Sieben Punkten von Stendal“ in den Gerichtssaal zurück. Wir forderten die Übertragung des Versorgungsvermögens im Tausch gegen die Kapitalbeteiligungen, Entflechtung und Eigentumstransfer nach dem Spaltungsgesetz, Hilfe beim Aufbau unter Verzicht auf § 5-Genehmigungen etc. Das Verfassungsgericht gab uns eine Frist bis 20.12.1992. Im Fall der Einigung sollten die Verfassungsbeschwerden bis zum 31.12.1992 zurückgenommen werden.
Am 6.11.1992 fand unter Vorsitz von OB Dr. Rommel, seinerzeit Präsident des Deutschen Städtetages und Präsident des Verbandes Kommunaler Unternehmen, ein erstes Gespräch in Stuttgart statt. OB Rommel informierte über einen Briefwechsel zwischen ihm und Bundeskanzler Kohl, der den Abschluss eines Vergleichs unterstütze, wobei allerdings auch die Braunkohleinteressen gewahrt sein müssten. Anwesend waren die Stromseite mit den Chefs der „Großen Drei“, Dr. Kunth von RWE, Herr Krämer von PreussenElektra und Dr. Holzer vom Bayernwerk, der Abteilungsleiter des BMWi sowie der Referent, Ministerialrat Cronenberg, die Treuhandanstalt Abteilung Kommunalvermögen mit Direktor Schöneich und Herrn Berndt, Herr Lange vom Deutschen Städtetag, der Geschäftsführer des VKU Zimmermann, wir mit OB Dr. Lehmann-Grube von Leipzig, OB Kwaschik aus Schwerin, Geschäftsführer Horstmann/Stendal und ich mit dem Kollegen Püttner und zwei Beobachtern der Gasseite. Alle Beteiligten erklärten Verständigungsbereitschaft. Die Stromseite war auch bereit, die Anlagenübertragung nicht von „Zwangsehen“ abhängig zu machen. Auch wurde die Verantwortlichkeit der Treuhandanstalt akzeptiert. Aber ein Dissens kam auf bei der Frage des Verfahrens. Die kommunale Seite bestand auf Abspaltung. Die Stromseite wollte Kauf gegen Aktienübertragung. Dabei müssten die Anlagen nach dem Sachzeitwert, die kommunale Kapitalbeteiligung am Regionalversorger nach dem Ertragswert bewertet werden. Das lief auf eine happige Zuzahlung der kommunalen Seite hinaus. Beide Seiten beriefen sich auf Passagen im schriftlich vorliegenden Vorschlag des Gerichts, der ihre Meinung angeblich stützte. Darüber ging man auseinander.
Читать дальше