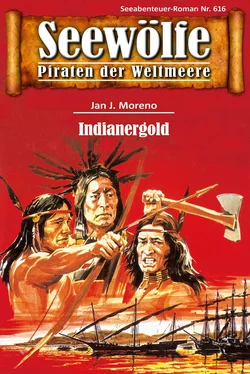Impressum
1976/2020 Pabel-Moewig Verlag KG,
Pabel ebook, Rastatt.
eISBN: 978-3-96688-030-5
Internet: www.vpm.deund E-Mail: info@vpm.de
Jan J. Moreno
In Virginia warten Tod und Schrecken auf die Pilger
Gestern noch zu Tode betrübt und heute schon himmelhoch jauchzend – so läßt sich das Verhalten der Pilger am besten beschreiben .
Seit dem ersten Landfall sind sie irgendwie verändert. Die Enge des Schiffes erscheint ihnen plötzlich qualvoll. Und die lange Zeit des Darbens versuchen sie zu vergessen, indem sie sich die Bäuche vollschlagen .
Lediglich drei Tage liegt die heilsame Bucht hinter uns, aber wir haben kein Fleisch mehr, und die Wasservorräte schwinden schnell. Dabei sind wir weiterhin gezwungen, gegen Wind und Strömung zu kreuzen .
Von der Schebecke wird signalisiert, daß wir abermals Land anlaufen .
Ich bin damit einverstanden, denn die „Pilgrim“ zieht erneut Wasser. Aber ich hoffe auch, daß dies unser letzter Ankerplatz vor dem Ziel sein wird …
Aus dem Logbuch der „Pilgrim“, Aufzeichnung des Kapitäns James Drinkwater, Ende Juli 1598 .
Die Hauptpersonen des Romans:
Frank Davenport– der adelige englische Abenteurer hat keine Skrupel, einen jungen Indianer niederzuschießen, um sich dessen goldene Halskette anzueignen.
Benjamin Dunsay– der Sohn eines Auswanderers wird von Indianern gefangen, und es steht schlecht für ihn.
Batuti– der Gambiamann muß als Bogenschütze zeigen, was er kann, um einen Totschlag zu verhindern.
Anna Keybridge– eine sehr resolute, aber auch hübsche Siedlerfrau, die Haare auf den Zähnen hat.
Philip Hasard Killigrew– sein Zorn gegen die drei adeligen Schnösel wächst weiter und brennt auf heißer Flamme.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Der Schatten des Indianers verschmolz fast mit dem sturmzerzausten Buschwerk. Er beobachtete.
Gerade einen Pfeilschuß entfernt briet Wildbret über mehreren Feuern. Der Seewind trug den verlockenden Geruch heran, ebenso wie das Lärmen der Männer, Frauen und Kinder, die über das große Wasser gefahren waren. Nicht weit draußen ankerten ihre Schiffe auf der sonnenüberfluteten See.
Eine Mischung aus Neugierde und Ablehnung bewegte den Indianer. Er hatte die seltsamen Stöcke der bleichhäutigen Fremden gesehen, die Blitz und Donner verschleuderten und die Tiere des Waldes töteten.
Zwölf Sommer lag es zurück, da waren die ersten Weißen erschienen. Weit im Süden, wo der Fluß ins Meer mündet, hatten sie ihre Hütten errichtet. Sie waren wie Termiten, die alles zerstörten, wenn man sie gewähren ließ.
Der Indianer faßte seinen Bogen fester. Ein Pfeil lag auf der Sehne, doch er würde ihn nicht benutzen.
Noch nicht.
Er hatte genug gesehen. So lautlos und geschmeidig, wie er erschienen war, verschwand er zwischen den knorrigen Kiefern.
„Ich pfeife auf Killigrews Anordnungen. Mir hat er überhaupt nichts zu sagen.“
Frank Davenport unterstrich seine Worte mit einer eindeutigen Geste, die keinerlei Zweifel daran offenließ, was Philip Hasard Killigrew ihn konnte.
Alec Morris lachte glucksend.
„Der Seewolf stirbt nicht im Bett“, prophezeite er. „Eines Tages wird ihm jemand eine fünf Inches lange Klinge zwischen die Rippen stoßen.“
„Zwischen die Schulterblätter, wolltest du wohl sagen“, berichtigte Sir William Godfrey, der älteste der drei adligen Abenteurer.
„Warum eigentlich nicht?“ Alec Morris’ hervorstechendste Charaktereigenschaft war seine Hinterhältigkeit – überheblich waren alle drei. Und was ihm an Körperkraft fehlte, glich er mit seinem Schandmaul wieder aus.
Nun war die Reihe an Godfrey, ein heiseres Lachen anzustimmen. „Behaupte bloß, du willst das tun.“
Jeder von ihnen hatte Grund, Killigrew in die tiefste Hölle zu wünschen. Aber sie hatten auch schmerzhaft erfahren müssen, daß sie gegen schwielige Seemannsfäuste nichts zu vermelden hatten.
„Reden wir über angenehmere Dinge“, schlug Morris vor.
„Gold …“ Frank Davenport grinste übers ganze Gesicht. Bei den horrenden Schulden, die er in England hinterlassen hatte, war es kein Wunder, daß ihm nur die Suche nach dem gelben Metall im Kopf herumspukte.
„… und Frauen“, fügte Morris hinzu. „Indianerfrauen, um genau zu sein. Ich habe gehört, sogar ihre Nachttöpfe seien aus Gold.“
Frank Davenports Augen begannen gierig zu glitzern.
Die Hähne der Pistolen gespannt, drangen sie tiefer in den Wald vor. Viele der uralten Kiefern waren so riesig, daß sie deren Stamm nur gemeinsam hätten umfassen können. Gefahr konnte überall lauern.
Um jeden Ärger aus dem Weg zu gehen, hatte Killigrew verboten, den Uferstreifen zu verlassen. Lediglich Jagdtrupps waren bisher weiter vorgedrungen.
Drückende Schwüle lastete über dem Land. Ein umgestürzter Baumstamm auf einer kleinen, sonnenüberfluteten Lichtung lud Davenport zum Ausruhen ein. Ächzend zog er ein spitzenbesetztes Tuch aus seinem Ärmel hervor und tupfte sich sorgsam den Schweiß von der Stirn.
„Es scheint mühsamer zu sein, dem Gold hinterherzulaufen, als es im Spiel zu gewinnen.“ Er seufzte ergeben.
„Ein bißchen was muß jeder für sein Glück tun“, erwiderte Sir William Godfrey. „Und sei es, nach einem verlausten Indianerdorf zu suchen.“
„Ich denke, wir brauchen nicht mehr weit zu gehen“, platzte Morris heraus. „Seht!“
Keine zehn Yards entfernt, wie aus dem Nichts heraus erschienen, stand ein Indianer, ein halbes Kind noch. Er schien über das Zusammentreffen nicht minder erstaunt als die drei Halunken.
„Laß die Pistole unten!“ zischte Godfrey.
Davenports hastige Bewegung hatte den Indianerjungen veranlaßt, den Bogen zu spannen. Mit unbewegter Miene starrte er die Fremden an.
„Seht ihr, was er um den Hals trägt?“ raunte Morris.
„Natürlich“, gab Davenport ebenso leise zurück. „Ich wußte es doch gleich.“
„Wir – Freunde“, sagte Sir Godfrey zu dem Jungen und unterstrich seine Behauptung mit einer entsprechenden Geste. Trotzdem wurde er nicht verstanden.
„Freunde“, wiederholte er betont langsam und versuchte es anschließend auf französisch und spanisch.
„Der Bursche kapiert nicht“, sagte Davenport. „Aber irgendwie müssen wir an seinen Schmuck rankommen.“
Godfrey trat einen vorsichtigen Schritt auf den Indianer zu. Er nestelte seinen Kugelbeutel vom Gürtel und wog ihn abschätzend in der Hand.
„Für dich“, sagte er. „Ein Geschenk.“
Der Junge erwiderte etwas in einer seltsam klingenden Sprache.
„Wenigstens bist du nicht taub“, sagte Godfrey. „Hier, fang!“
Er warf den Kugelbeutel. Der Indianer reagierte blitzschnell. Ohne die drei aus den Augen zu lassen oder gar den Pfeil von der Sehne zu nehmen, öffnete er den Beutel. Natürlich wußte er mit den runden Bleikugeln wenig anzufangen. Hastig steckte er eine zwischen die Zähne und kaute eine Weile darauf herum. Angewidert spie er dann aus.
William Godfrey lächelte, denn Lächeln schafft Vertrauen. Mit beiden Händen hob er seine Pistole.
„Das hier, siehst du, großes Geschenk. Bummbumm und Feind tot.“
Der Indianer verzog keine Miene. Allerdings hing sein Blick jetzt mehr an dem Feuerrohr als an den Fremden. Und die drei wiederum taxierten begehrlich seinen kunstvoll gearbeiteten, aus Goldplättchen bestehenden Halsschmuck.
Читать дальше