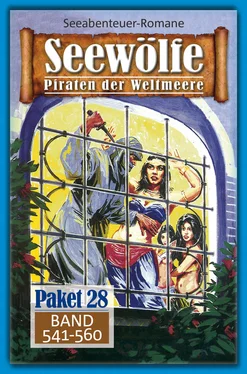„Lüge!“ brüllte der Kurde.
„Welcher Wein denn?“ fragte der Grinser.
Aber er erhielt keine Antwort. Alle starrten nur auf die Kämpfer. Für einen von beiden mußte das Messerduell tödlich enden. Daran gab es keinen Zweifel.
„Ich bringe dich um, du Hund!“ heulte Ebel Schachnam.
„Das schaffst du nicht!“ höhnte der Kurde.
„Verrecke!“
„Fahr zur Hölle!“
Jählings warf sich Ebel auf seinen Unterführer. Dieses Mal konnte Güner nicht schnell genug reagieren. Das Messer traf ihn. Er stöhnte auf, stieß aber selbst zu. Ebel tänzelte zur Seite. Beide Männer bluteten, aber Güner wankte stark.
„Stirb!“ brüllte der Bärtige. Er unternahm wieder einen Angriff. Noch einmal stach er auf den Kurden ein – und Güner sank blutüberströmt zu Boden. Er hob noch die rechte Hand. Der Dolch entglitt seinen Fingern. Sein Blick war auf Ebel Schachnam gerichtet. Er brach vollends zusammen und regte sich nicht mehr.
„Erledigt“, sagte Ebel Schachnam. Verächtlich spuckte er vor dem Kurden aus. „So ergeht es allen, die gegen mich anstinken wollen.“ Herausfordernd sah er seine Kerle an. „Hat noch jemand Lust, mit mir zu kämpfen?“
Keiner trat vor. Die Kerle schwiegen und hielten ihre Blicke gesenkt. Ebel grinste.
„Schmeißt den Schwachkopf in den Fluß“, sagte er. „Die Wasserratten sollen ihn fressen.“
Das merkwürdige Trio schlug im verblassenden Licht des Tages am Ufer des Tigris seinen Lagerplatz auf. Die Rüstung von Branco Fernan klapperte und rasselte, als er absaß. Das Visier fiel zu. Er öffnete es wieder und schritt mit stelzenden, steif wirkenden Bewegungen auf und ab.
„Keine Schlangen“, sagte er.
„Keine Wölfe“, vermeldete Ton de Wit, der sich im Gebüsch umgesehen hatte.
„Hier gibt es doch gar keine Wölfe, du Narr“, sagte Ludmilla.
„Man kann’s nie wissen“, erwiderte der Riese. „Und du sollst mich nicht so nennen, sonst versohle ich dir den Hintern.“
„Ja, schon gut“, flüsterte das Mädchen.
Der Riese hatte sie schon einmal verhauen, als sie zu aufsässig geworden war. Davon hatte sie jetzt noch genug.
„Hier laßt uns rasten“, sagte Branco Fernan. „Hier laßt uns Burgen bauen und seßhaft werden.“
Ludmillas Augen weiteten sich. „Ist das dein Ernst?“
„Wir wollen die Ungläubigen in aller Welt bekehren.“
„Und ich will nach Hause.“
„Der Tag ist nicht mehr fern, mein Kind, an dem du deine Windmühlen wiedersehen wirst, das habe ich dir versprochen.“ Branco Fernan sah sie streng an. „Habe ich dich jemals angelogen?“
„Nein.“
Ton de Wit grinste. Er hatte ein paar Datteln aufgelesen und hielt sie dem Mädchen vor die Nase. „Willst du mal kosten?“
„Hau bloß mit deinen Datteln ab!“
„Lieber ein Stück Pökelfleisch?“ fragte der Riese.
„Ja.“
Während sie gemeinsam ihr karges Abendessen vorbereiteten, dachte Ludmilla nach. Schon oft hatte sie sich die Frage gestellt, ob dieser Branco Fernan, der eigentlich Willem Smitt hieß, richtig im Kopf war. Was er eigentlich in diesem Land am Euphrat und Tigris wollte, war ihr immer noch nicht klar.
Sie hatte ihn in Holland kennengelernt. Ludmilla war vor zwei Jahren von zu Hause ausgerissen. Das Auskneifen war ihr sozusagen mit in die Wiege gelegt worden. Es war ihre fixe Idee. Immer wieder mußte sie einfach abhauen, ganz gleich, wo sie gerade war.
Ton de Witt hatte einmal gesagt, sie habe das Wesen einer streunenden Katze.
Nun, Ludmilla war in einem Bordell von Den Haag gelandet. Es wäre ihr schlecht ergangen – die Kerle in dem Freudenhaus benahmen sich wie die Tiere. Aber plötzlich erschien dieser Ritter Branco Fernan und forderte die Huren auf, ihr fluchwürdiges Leben aufzugeben. Anderenfalls würde Gott sie furchtbar strafen.
Natürlich hatten die ausgekochten Huren gelacht und dem Kerlchen ihre Dienste angeboten. Aber Ludmilla hatte die Gelegenheit beim Schopf gepackt und war mit dem Männchen ausgekniffen. Die Bordellmutter hatte sie zwar keifend verfolgt, aber plötzlich war Ton de Wit zur Stelle gewesen.
Eine Maulschelle des Riesen hatte genügt, und die Madam war heulend in ihr gastliches Haus geflüchtet. Ludmilla war bei Branco und Ton geblieben.
Sie hatte erfahren, daß die beiden aus der tiefsten Provinz stammten. Der Riese war schon immer Branco Fernans Diener gewesen. Er war ihm treu ergeben. Irgendwann hatten sie den Plan gefaßt, durch die Lande zu ziehen, um Heiden zu bekehren. Gott habe ihm diesen Auftrag erteilt, behauptete der Ritter.
So hatte man zu dritt Holland verlassen und war mit dem Pferd quer durch Europa gezogen. Ludmilla kannte sich in der Erdkunde nicht aus. Was das für Länder waren, durch die sie gereist waren, wußte sie immer noch nicht recht. Deutschland, Ungarn, Griechenland und die Türkei – noch nie hatte sie früher von solchen Plätzen und Namen gehört.
Aber sie vertraute diesem Eisenmann, so seltsam er sein mochte. Er brachte einem eher das Lachen als das Fürchten bei, und doch spürte sie tief in ihrem Inneren, daß er ein aufrichtiger und guter Mann war, der nur das Beste wollte.
Verrückt war er wohl nicht. Ton de Wit war auch kein Blödian, obwohl er meistens dummes Zeug redete, sobald er den Mund auftat. Aber irgendwie fühlte sich das Mädchen wohl bei ihnen. Nie wäre es den beiden Männern eingefallen, sie unsittlich anzufassen, Sie benahmen sich wie die Mönche.
Nur manchmal packte Ludmilla eben das Heimweh. Sie seufzte. Wollte sie wirklich nach Hause zurück? Doch, gewiß. Schon allein wegen der feinen Sachen, die es dort zu essen gab.
„Was ist, was ficht dich an?“ fragte Branco Fernan.
„Ach, nichts“, erwiderte sie und stand auf. „Ich gehe Wasser holen.“ Sie griff sich den leeren Schlauch, der an Jolantes Sattel hing.
Der Riese war mit zwei Schritten neben ihr. „Ich begleite dich.“
„Laß mich in Ruhe.“
„Das tue ich sicher, aber ich begleite dich.“
„Ich habe keine Angst“, sagte sie trotzig.
„Nein, aber du könntest wieder weglaufen. Dann landest du in einem Sumpfloch, und wir haben wieder unsere Mühe, bis wir dich finden.“
Ludmillas Augen sprühten Zorn und Feuer. „Ich reiße nicht aus, das verspreche ich dir.“
Branco Fernan nickte. Prompt klappte das Visier zu. „Du hast schon sooft so viel versprochen, mein Kind“, klang es hohl aus dem Inneren des Helmes. „Ich frage dich, wie sollen wir dem noch Glauben schenken?“
„Rutscht mir doch den Buckel runter, ihr Narren“, sagte sie schroff. Dann ging sie zum Ufer des Flusses.
Ton de Wit marschierte mit vergnügtem Gesicht hinter ihr her.
Ludmilla trat ans Ufer des Tigris, bückte sich und ließ Wasser in den Schlauch laufen. In den ersten Tagen hatte sie Angst gehabt, das Wasser könne vergiftet sein. Dann aber hatte sie sich von Branco Fernan überzeugen lassen, daß man es genießen konnte.
Überhaupt schien der Mann immer alles zu wissen. Er steckte voller Überraschungen. Er war klug und schrullig, intelligent und total verdreht.
Das Mädchen hob etwas den Kopf und spähte über den Fluß. Da – was war das? Schwamm da nicht etwas?
„Sieh mal, Ton“, sagte sie leise. „Da treibt was.“
„Ach, du willst mich bloß ablenken.“
„Unsinn, es treibt auf uns zu.“
Er kniff die Augen zusammen. „Es ist zu dunkel, ich kann nichts erkennen.“
„Nein? Schau richtig hin. Das ist eine Gestalt, ein Körper!“
„Ja, du hast Katzenaugen“, sagte der Riese.
„Ein Mensch“, sagte Ludmilla entsetzt. „Da schwimmt ein Mensch!“
„Bewegt er sich?“
„Nein.“
„Dann schwimmt er nicht“, korrigierte sie der Riese. „Er treibt.“
Читать дальше