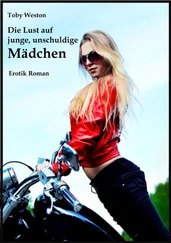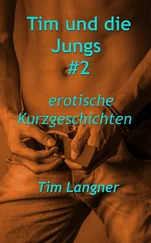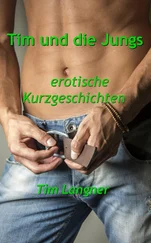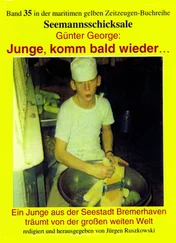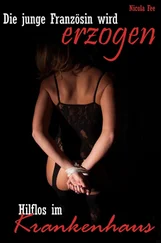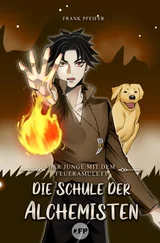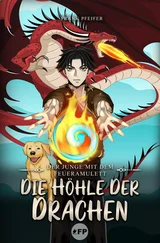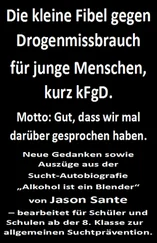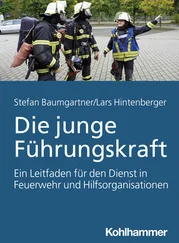Wenig passend erscheint auch eine Gleichsetzung der Begriffe »Generation Y« und »Generation Praktikum«. Eine Ausnutzung von Studienabsolventen in der Wirtschaft über »Praktikantenverträge« ist zweifellos erfolgt. Ungeachtet dessen: Noch nie waren Ausbildungsmöglichkeiten (zumindest bis zu der Zeit vor Corona) so gut und breit wie heute. Und bei denjenigen Personen, die die Generation Y ausmachen (Schröder 2018), haben die Eltern in der Regel dafür gesorgt, dass ihre Kinder unter guten Bedingungen leben können.
Die häufig von »Helikoptereltern« aufgestellte Behauptung, ihre Kinder hätten Probleme, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen (»Fear of Missing out Scale« (FoMoS)«), dürfte zutreffen. Ursächlich dafür dürfte allerdings die elterliche Erziehung sein. »Alles den Kindern abnehmen und geben zu wollen« resultiert eben in deren Unselbstständigkeit (Krauss 2012). Dies wird im Krankenhaus durch eine teilweise überzogene Erwartungshaltung der jungen Generation gegenüber ihren Vorgesetzten verifiziert. Einerseits möchte man »frei wie im Elternhaus walten können«, andererseits aber vom Führungspersonal »an der Hand geführt werden«.
Das Erziehungsmodell »Freie Fahrt für freie Kinder ohne jegliche Einschränkung und mit Elterntaxicharakter« dürfte für die Gesellschaft, und damit auch für Unternehmen, wohl kein Erfolgsmodell sein.
Was die Generation Y möchte
Bezug ist hier vor allem die »Selbsteinschätzung« einer Vertreterin der Generation Y (Bund 2014), die mit ihrer Generation Folgendes verbindet:
• Freiräume bei der Arbeit
• Zeit für Familie und Freizeit
• Selbstbestimmtes Arbeiten
• Kontinuierliche Rückkopplung (Feedback)
• Zugang zum Internet und innovativen digitalen Techniken
• Spaß bei der Arbeit
• Entscheidung zu Überstunden in eigener Regie
Dies sind gute und teilweise sinnvolle Forderungen, die erfüllt werden sollten. Eher naiv erscheint die Feststellung der Autorin: Wir wissen, was wir wollen: »Anders leben, anders arbeiten, anders sein«. Interessant ist, dass die Frage des Status und der Honorierung eher im Hintergrund steht (»Glück bedeutet mehr als Geld«) (Bund 2014, S. 25).
Konkrete berechtigte Forderungen
Die meisten Forderungen der Generation Y sind berechtigt (s. ergänzend Aulenkamp u. a. 2020):
• Die Realisierung einer guten Vereinbarung von Familie und Arbeit ist überfällig und hätte längst realisiert werden müssen.
• Hierarchische Strukturen mit »Halbgott-in Weiß-Mentalität« bei Ärzten passen nicht mehr in die Zeit.
• Prozessorientierte Strukturen mit flachen Hierarchien und therapeutischen Teams aus Ärzten und Pflege sind zukunftsweisend, die funktionale Organisation mit Fachabteilungen unter Führung von Chefärzten ist eher ein Auslaufmodell.
• Neue Führungsmodelle mit Teamorientierung und kollegialer Entscheidungsfindung sind wegweisend. Sie fördern den Kooperationsgedanken und sind Voraussetzung für notwendige neue innovative Versorgungsmodelle.
• Der massiv bestehende Personalmangel bedarf der Beseitigung. Dies gilt nicht nur für normale Zeiten, sondern muss auch vorbeugend für Krisen wie Corona gelten.
• Bei zunehmender Arbeitsdichte kommt es zu Stress und Erkrankungen der Mitarbeiter. Dies wirkt sich auf alle, und damit natürlich auch auf Neueinsteiger, aus. Entsprechenden Fehlentwicklungen ist ebenfalls vorzubeugen (z. B. durch zielorientierte Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung), um die Existenz von Krankenhäusern nicht zu gefährden.
• Die Forderung nach Nutzung digitaler Medien und die Einstimmung auf die Transformation zum digitalen Krankenhaus ist unverzichtbar. Zeigt das Krankenhaus hier seinen Mitarbeitern nicht die notwendigen Wege auf, wird es dauerhaft nicht wettbewerbsfähig sein können.
Es darf nicht wundern, wenn bei Aufrechterhaltung der genannten Defizite die junge Generation für die herausfordernde und anstrengende Tätigkeit im Krankenhaus wenig motiviert ist und als Folge davon möglicherweise Arbeitsfelder in anderen Bereichen oder im Ausland bevorzugt.
Übergreifend betrachtet, sind die geforderten Veränderungen überfällig. Sie hätten längst beseitigt werden müssen. Sie sind somit keinesfalls neu. Die Generation Y hat nur gewagt, sie offen anzusprechen und einzufordern. Und das ist gut so! (Hellmann 2015c, 2015d)
Forderungen der Generation Y mit Notwendigkeit der Gegensteuerung
Die beschriebene, z. T. überproportionierte intensive Betreuung durch »Helikoptereltern« (Krauss 2014), kann in einer vereinnahmenden Haltung gegenüber Führungskräften resultieren.
So weisen Berichte aus Krankenhäusern und Aussagen der Generation selbst (Bund 2014) darauf hin, dass eine »Rundumbetreuung mit an der Hand führen« kategorisch eingefordert wird. Das, was man im Elternhaus erfahren hat, möchte man auch im Arbeitsbereich realisiert haben.
Die Forderung nach »Teamorientierung« kann allerdings überraschen. Der Teamgedanke hatte im Elternhaus häufig keinen Platz. Die Eltern lieferten, die Kinder empfingen. Neueinsteiger im Krankenhaus scheinen in der Regel nicht auf Teamarbeit eingestellt.
Problematisch für Krankenhäuser ist ebenfalls ein Selbstmanagement, das mehr auf das eigene Ich als auf die Belange der Patienten fokussiert (Hellmann 2019). Tolerabel ist dies nicht. Im Mittelpunkt der Bemühungen des Krankenhauses muss der Patient stehen. Dieser Prämisse muss sich das Selbstmanagement der jungen Generation selbstverständlich unterordnen!
Defizite im Selbstmanagement der jungen Generation müssen nicht ins Krankenhaus Eingang finden. Ihnen könnte grundsätzlich im Rahmen des Medizinstudiums durch Einbeziehung einschlägiger Schulungen vorgebeugt werden. Solange dies nicht erfolgt, ist das Krankenhaus Lückenbüßer. Ähnliches gilt für die Erwartung einer Rundumbetreuung im Krankenhaus (  Abb. 1.1).
Abb. 1.1).
Zusammenarbeit ist erlernbar
Die junge Generation wünscht sich eine enge und gute Zusammenarbeit von Pflegekräften und Ärzten (Schulte und Severin 2020, Häußler 2020, Hommel 2019). Dieser Wunsch verdient Respekt. Nachhaltig wird er jedoch nur realisierbar sein, wenn Gesundheitspolitik und Gesetzgeber sich endlich konkret festlegen, welchen Stellenwert Pflege zukünftig haben soll und welche (erweiterten) Aufgaben ihr zukünftig zugeordnet werden sollen (Ewers und Herinek 2020). Dass dies hochwertige und dem Qualifikationsprofil von Pflegenden angemessene Aufgaben sein müssen, versteht sich von selbst. Lokale Aktivitäten zur notwendigen Aufwertung der Pflege, wie sie in einzelnen Krankenhäusern erfolgen (Said und Wolz 2019, Noetzel und Schneider 2020, Stratmeyer u. a. 2020), sind eine gute Sache. Das grundlegende Problem einer angemessenen gesetzlich basierten und nachhaltigen Wertigkeit der Pflege wird dadurch aber nicht gelöst.
Möglichkeiten des Erlernens von Zusammenarbeit
Zwei Wege bieten sich vor allem an:
• Lernen in Schulungen auf eher theoretischer
Basis Beispielhaft seien hier wegweisende Projekte der Robert-Bosch-Stiftung (Höppner und Büscher 2011, Körner und Becker 2018) unter dem Titel »Operation Team« mit dem Fokus auf Respekt, Wertschätzung und Verständnis für die jeweilige andere Berufsgruppe erwähnt. Inzwischen gibt es zahlreiche ähnliche Initiativen.
• Lernen über Projekte in der Berufspraxis
Hier engagieren sich erfreulicherweise zunehmend junge Ärzte. Ein prägnantes Beispiel ist das Engagement von Dr. Sebastian Bode, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Freiburg. Auf einer interprofessionellen Ausbildungsstation lernen angehende Pflegefachkräfte gemeinsam mit Studierenden der Medizin (Häußler 2020).
Читать дальше
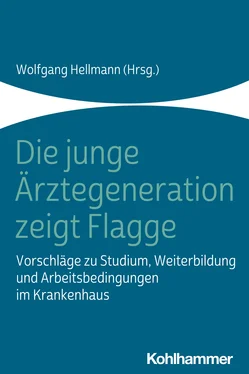
 Abb. 1.1).
Abb. 1.1).