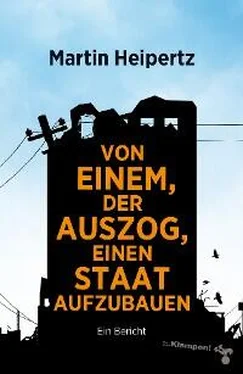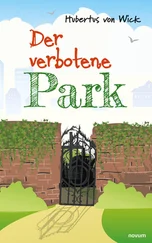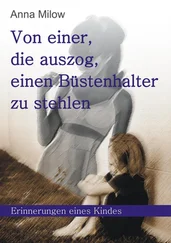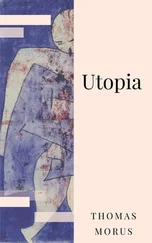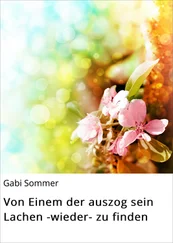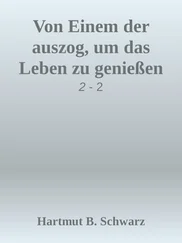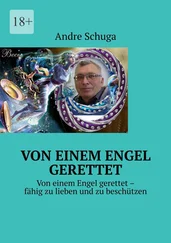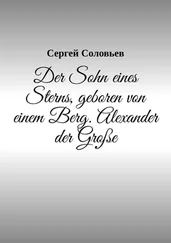Kaminek entnahm meinen Unterlagen, daß ich ebenfalls Infanterist und Offizier der Reserve war. Das erfreute ihn, und er meinte, daß er sich die Hälfte seiner nun folgenden Ausführungen sparen könne, da ich das Metier ja kenne. Ich erhielt zusätzlich zu einem dienstlichen Mobiltelephon ein weitreichendes Motorola-Handfunkgerät, wie ich es von der Bundeswehr her tatsächlich kannte, und eine kurze Einweisung in die Aufteilung der Frequenzen sowie die verschiedenen Funkkreise, die zwischen Nato, Uno und unseren neuen ICO-Einheiten in Betrieb waren, außerdem Verhaltensregeln für die unterschiedlichen Sicherheitsstufen und Angaben zu dem Sammelplatz einer möglichen Evakuierung durch Luftlandetruppen. Im Vorfeld der für den nächsten Tag vorgesehenen Unabhängigkeitserklärung war die Sicherheitsstufe erhöht worden, so daß wir in einer festgelegten Reihenfolge mehrmals täglich einen Funkappell durchführten und uns in ständiger Rufbereitschaft befanden. Ich unterschrieb eine Vielzahl von Belehrungen, Erklärungen und Belegen, die den Umgang mit sicherheitsrelevanten Informationen, Nachrichtendiensten, Sicherheitsbestimmungen usw. betrafen, und bemühte mich, alle Anweisungen mit einem Gesichtsausdruck von Routine und Vorverständnis aufzufassen. Das schien mir zu gelingen, denn in kurzer Zeit war die Prozedur beendet, und ich erhielt abschließend eine elektronische Marke zum Eintritt in das Gebäude, einen Schlüssel für mein Büro und zum Abschied einen kameradschaftlichen Schulterklaps von Kaminek, dessen Wucht mich leicht in die Knie gehen ließ.
Aidan brachte mich, dermaßen ausgestattet, zu einem zentral gelegenen Hotel und lud mein Gepäck aus, während ich mich am Tresen anmeldete. Dann war ich mir selbst überlassen. Für fünf Tage würde die Unterkunft im Hotel vom ICO bezahlt werden; in dieser Frist mußte ich eine Wohnung finden. Diese und alle anderen Ungewißheiten schob ich beiseite, richtete mich rasch ein und verließ das enge Zimmer wieder, um auf eigene Faust die Stadt zu erkunden. Mit dem Funkgerät im Holster unter meiner Jacke trat ich vor die Tür. Es war der Vorabend der Unabhängigkeitserklärung, und schnell war die Dunkelheit hereingebrochen. Da wir uns am äußeren Rand der mitteleuropäischen Winterzeitzone befanden, war der Himmel bereits am frühen Abend finster wie in tiefer Nacht, dazu sternenklar. Die Straßen waren noch belebter als zuvor, und die meisten Fahrzeuge promenierten in Vorfreude auf den Moment der Unabhängigkeit. Viele der Automobile waren mit Menschen überladen, die trotz der niedrigen Temperatur aus den Fenstern lehnten oder auf den Dächern und Motorhauben hockten. Sie streckten ihre Arme mit dem Victory-Zeichen empor und ließen große, blutrote, albanische Fahnen über ihren Köpfen wehen. Lautes Hupen und schrille Rufe erschollen durch die Nacht, eine verhaltene Spannung schien über Priština zu liegen.
So fühlt es sich an, wenn Geschichte geschieht, dachte ich zufrieden und sah mich ein wenig an die Zeit der Wende und meine Eindrücke des Jahres 1989 erinnert. Zwischen dem hin und her brandenden Verkehr und einer dichten Menge von Fußgängern erreichte ich einen kleinen Platz. Fast ausschließlich Männer waren unterwegs, mit dunklen Haaren und Augen, die meisten auch dunkel gekleidet. Doch einige Grüppchen von Jugendlichen rannten zwischen den Männern kreuz und quer, schwenkten ihre Fahnen, lärmten in die Nacht hinein und ließen gelegentlich eine Silvesterrakete in den schwarzen Himmel steigen. In der Menge bewegte sich außerdem ein besonderes Völkchen, das mit Photoapparaten, Kameras und Mikrophonen auf der Jagd nach schönen Bildern umherlief: Reporter der internationalen Nachrichtenagenturen, Fernsehsender und Zeitschriften. Ihre Übertragungswagen und Antennenschüsseln waren am Rande des Platzes versammelt und versicherten allen Anwesenden nochmals eindrücklich, daß sie einen historischen Moment zu erleben im Begriffe standen und die Augen der Welt sich für einen kurzen Wimpernschlag auf das richteten, was gerade jetzt in Priština geschah. Mir jedoch zerstörte die Anwesenheit der Reporter den Eindruck des Besonderen. Immer wenn eine Kamera auftauchte, wurden die Menschen schlagartig zu schlechten Schauspielern. Sie versammelten sich vor der Linse, und ihre Ekstase war nur mehr gespielt. Sie vollzogen ihre Veitstänze nicht nur vor dem Objektiv, sondern für das Objektiv. Genauso gut hätte sich ihr Verhalten auf den glücklichen Ausgang eines Fußball-Länderspiels beziehen können, fand ich und war enttäuscht ob der plötzlich greifbar gewordenen gekünstelten Banalität der gesamten Situation. Es war wie bei Heisenberg: Die Beobachtung eines Gegenstands verändert die Eigenschaft desselben.
Gerade, als ich Überlegungen zum Abendessen anstellen wollte, erhielt ich eine Kurznachricht von Veronika Winzmann. Sie kam vom Ratssekretariat der EU und war für unser Aufbauteam so etwas wie die Mutter der Kompanie. Über eine persönliche Empfehlung hatte sie maßgeblich meine Rekrutierung für diese Aufgabe betrieben. Zuletzt hatten wir uns in Brüssel bei meinen Einstellungsgesprächen gesehen, seither standen wir per E-Mail zu allen vorbereitenden Fragen in Kontakt. Nun erkundigte sie sich, ob ich gut eingetroffen sei und Lust auf ein gemeinsames Abendessen habe. Sogleich sagte ich zu, erhielt eine Wegbeschreibung als Antwort und fand mich kurz darauf in einem gemütlichen Restaurant inmitten einer kleinen, munteren Tischrunde wieder.
In Priština konnte man als Macchiato-Diplomat zu meiner freudigen Überraschung vielerorts vorzüglich und dazu preiswert essen. Die Gastwirte waren findungsreiche Improvisationskünstler und offen für kulinarische Einflüsse aus ganz Europa – nicht zuletzt, weil viele von ihnen als Flüchtlinge oder Gastarbeiter in den Küchen aller Herren Länder gearbeitet hatten. Die Gastronomie ist einer der für Flüchtlinge am ehesten zugänglichen Bereiche unseres überregulierten Arbeitsmarktes, und sie bedarf nur geringer Sprachkenntnisse. Die dort empfangenen Anregungen verquickten die Wirte, zurück in der Heimat, mit der kulinarischen Tradition des Balkans, die vor allem für frisches, herzhaftes und reichhaltiges Essen mit gegrilltem Fleisch stand. Dazu floß das gute, kühle Peja-Beer aus der deutschen Brauanlage in Strömen, für gewöhnlich gefolgt vom ortsüblichen Raki, wie die Albaner den Slibowitz nennen.
Zwischen Serben und Albanern herrschte die gleiche große Nähe in den Bereichen der Gaumenfreuden und der Musik wie zwischen Griechen und Türken oder zwischen Iren und Engländern, Bayern und Tirolern, Israelis und Libanesen. Natürlich würde jede Seite diesen Schluß weit von sich weisen, aber nach einem ausgiebigen Gastmahl in einem serbischen Restaurant und tags darauf einem ähnlichen Erlebnis in einem traditionellen albanischen Betrieb mit Tanz und Musik wären Verwandtschaft und Freundschaft dieser Völker jedem Außenstehenden plausibler erschienen als ihre erbitterte Feindschaft. Nur Schweinefleisch gab es bei den Albanern keines. In der Regel waren sie keine strengen Moslems, aber zumindest diese Vorschrift des Propheten befolgten sie penibel.
Später fuhren wir daher manchmal in die neben Priština gelegene serbische Enklave Gračanica. Dort konnte man erstens das bedeutende Frauenkloster besuchen, das mitsamt seinen Fresken von einer Handvoll junger, blonder, schwedischer KFOR-Hünen mit Knabengesichtern bewacht wurde. Zweitens konnte man in einem der wenigen, aber grundsoliden Straßenlokale Schweinefleisch essen und beim Metzger eine Wurst kaufen.
In dem Kloster war auf einem der bis über das sechzehnte Jahrhundert hinaus zurückzudatierenden Fresken die Höllenfahrt der Sünder dargestellt, und diese waren anhand ihrer Tracht gut als Türken zu erkennen. Den Abbildern der Heiligen hatten die Nachfahren der türkischen Gefolgsleute in einem späteren Zeitalter die Augen ausgekratzt, und ich war erzürnt über die zahlreichen Spuren des Vandalismus auch aus jüngster Zeit, die in der Kirche zu sehen waren.
Читать дальше