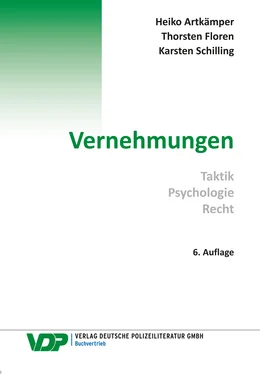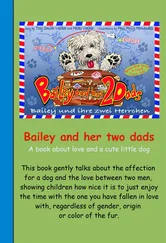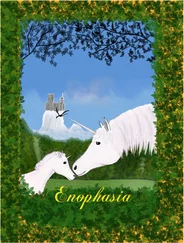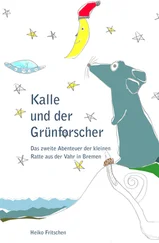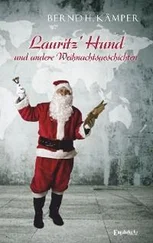399 Daneben gibt es allerdings auch ein mögliches Feld der Aussagemotivation polizeilicher Zeugen, das für alle Verfahrensbeteiligten regelmäßig ein Dunkelfeld bleibt: Welche polizeiinternen formellen und informellen Konsequenzen zeitigt eine polizeiliche Aussage, die Fehler bei den Ermittlungen, Belehrungen etc. wahrheitsgemäß offenlegt für den Polizeibeamten? Es dürfte außer Frage stehen, dass dies relevante Faktoren für die Beurteilung auch inhaltlicher Aussagemotive polizeilicher Zeugen sind.“
400 Eine im Jahr 2016 erschienene Veröffentlichung von Gerst präsentiert auf knapp 600 Seiten Vernehmungssituationen und Vernehmungstechniken – auch bezogen auf Berufszeugen wie Polizeibeamte. 29
401 Polizeibeamte neigen dazu, sich mit ihren Verfahrenzu identifizieren, mit der Folge, dass in der Hauptverhandlung „ihr“ Fall zur Entscheidung steht; 30demgemäß empfinden sie einen Freispruch oder eine Einstellung des Verfahrens als (persönliche) Niederlage.
Beispiel:
402Exemplarisch für diese Einstellung dürfte die bei der Rückkehr zur Dienststelle häufig gestellte Frage „Hast du gewonnen oder verloren?“ sein .
403 Eine derartige Sichtweise ist in doppelter Hinsicht unzutreffend: Zum einen verkennt sie, dass es in der Hauptverhandlung um die Nachweisbarkeit der dem Beschuldigten zur Last gelegten Tat im prozessualen Sinne geht; zum anderen offenbart sie die fehlende Professionalitätund die damit denknotwendig verbundene Trennung von Person und Sache.
404Bender/Nack/Treuer , die als führende Juristen bei der Frage der Tatsachenfeststellung vor Gericht gelten und als ehemalige Richter (am OLG bzw. BGH) über einen parteiischen Zweifel erhaben sind, haben das Dilemma des Berufszeugen„Polizeibeamter“ zutreffend beschrieben: „Sachverstand und Übung machen ihn in mancher Hinsicht zu einem überdurchschnittlich zuverlässigen Zeugen. Vorverständnis, Berufsehre, Gruppenkonformität und Erfolgsdruck aber können ihn manchmal zu einem für den Beschuldigten problematischen Zeugen werden lassen.“ 31Sie gelangen daher nachvollziehbar zu Plus- und Minuspunkten, derer sich der Beamte bewusst sein muss: 32
Bonus: Erfahrung, Aufmerksamkeit und Interesse
Malus: Vorverständnis, Routinegeschehen, Berufsehre und Gruppenkonformität.
405 Dass derartige Determinanten bewusst oder unbewusst eine Rolle spielen und das Aussageverhalten beeinflussen können, kann kaum bestritten werden; die damit verbundenen Gefahren werden minimiert, wenn sie erkannt werden.
4.5.3Notwendige Verteidigung bei Polizeizeugen?
406 Polizeibeamte treffen in Hauptverhandlungen auch vor dem Einzelrichter immer häufiger auf Verteidiger, was zum einen auf die Existenz von Rechtsschutzversicherungen zurückzuführen ist, zum anderen aber auch auf die Tendenz der Rechtsprechung, in immer größerem Maße die Notwendigkeit einer Pflichtverteidigungzu bejahen.
|
Praxistipp: |
| 407 |
Aktuell gibt es bereits Entscheidungen, die einen Fall notwendiger Verteidigung bereits dann annehmen, wenn alle Belastungszeugen Polizeibeamtesind und/oder Aktenkenntnisse erforderlich scheinen. 33Bei der Rekonstruktion polizeilicher Vernehmungen, in denen sich der Beschuldigte geständig eingelassen hat, dürften beide Voraussetzungen regelmäßig erfüllt sein. |
4.5.4Strategien und Strukturen aggressiver Verteidigung gegenüber Polizeibeamten
408 Die Erwartungen und Anforderungen, die an einen Polizeibeamten als Zeugen vor Gericht gestellt werden, sind sicherlich hoch. Auf der anderen Seite gerät er regelmäßig „in das Visier” der Verteidigung, da seine Ermittlungen mit dazu beigetragen haben, dass diese Hauptverhandlung gegen den Angeklagten stattfindet. Insoweit muss der Polizeibeamte wenigstens grob mögliche Verteidigungsstrategien und – differenzierter – die Strukturen und Befragungstaktiken (er)kennen.
409 Eine gegenüber Polizeibeamten aggressive Verteidigungerklärt sich vor dem Ziel, einen Rollentauschdurchzuführen: Der Polizeibeamte soll vom Zeugen zum Angeklagten gemacht werden, wobei gerne ausgenutzt wird, dass selbst Polizeibeamte den (eingeschränkten) formalen Rechtmäßigkeitsbegriff nicht oder nicht hinreichend genau kennen.
410 Das Fragerecht wird dazu benutzt, durch suggestives Verhalten und/oder Suggestivbemerkungen den Zeugen zu verunsichern („Sie müssten doch wissen, dass …”, „es gehört zu Ihren Berufspflichten, worauf ich Sie ausdrücklich hinweise …”). Diese sind hier weniger gefährlich als gewisse suggestive Verhaltensweisen. Zu Letzten zählt der sogenannte Sieben-Sekunden-Trick, bei dem versucht wird, den Zeugen dazu zu bringen, sich den Erwartungen des Fragenden anzupassen und wunschgemäß suggestive Lücken in der Frage auszufüllen.
4.5.4.1Verteidigungsstrategien
411 Teilweise wird der Versuch unternommen, das Verteidigungsverhalten als Verteidigungsstrategien zu kategorisieren und deren Merkmale aufzuzeigen, um Empfehlungen für Reaktionen des Zeugen zu geben. 34So werden u. a. eine Verhinderungs-, Verunsicherungs-, Rollentausch-, Provokations-, Detail- und eine Rechtswidrigkeitsstrategieunterschieden.
Damit dürfte dem Polizeibeamten für seine Zeugenrolle wenig geholfen sein, zumal die Strategien kombinierbar und ihre Grenzen fließend sind.
4.5.4.2Strukturelle Aspekte aggressiver Verteidigung im Rahmen der Befragung und Reaktionsmöglichkeiten von Polizeibeamten
412 Sinnvoller erscheint es, die hinter einer aggressiven Befragung stehenden Strukturen darzustellen, um adäquate Reaktionen des Zeugen auf derartige Aktionen zu ermöglichen.
4.5.4.2.1Unterbrechungen, Vernehmungsversuche und Vorwürfe
413 Teilweise kommt es zu Unterbrechungendes freien Berichts (durch Fragen), Vernehmungsversuchen(„jetzt fangen wir noch mal ganz von vorne an”) und Vorwürfen dergestalt, dass der Verteidiger keine Fragen stellt, sondern Statementsabgibt (die keine Frage enthalten). In diesen Fällen wird dann häufig auch die Rechtswidrigkeit polizeilicher Maßnahmen unterstellt bzw. suggeriert.
|
Praxistipp: |
| 414 |
Der Zeuge sollte auf die Regelungen des § 69 Abs. 1 und 2 StPO verweisen; wird keine Frage gestellt, so besteht auch keine Notwendigkeit für eine Antwort (und erst recht nicht für eine Konversation). |
4.5.4.2.2Erforschung der Persönlichkeit und des Privatlebens
415 Eine Erforschung der Persönlichkeit findet häufig schon bei der Angabe der Personalienstatt; der Zeuge wird – nach Angabe des Dienstortes – zu seinem Wohnort befragt oder diese Frage verkappt (z. B. als Frage nach der Angabe der Festnetztelefonnummer) gestellt.
|
Praxistipp: |
| 416 |
§ 68 StPO setzt hier eindeutige Grenzen. |
417 Grundsätzlich zulässig sind hingegen solche Fragen, die sich auf den beruflichen Werdegangund möglicherweise erworbene Qualifikationen des Polizeibeamten beziehen; eine Grenze bilden hier solche Antworten, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen (§ 54 StPO).
Читать дальше