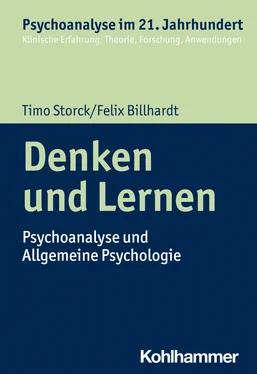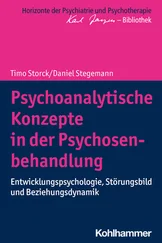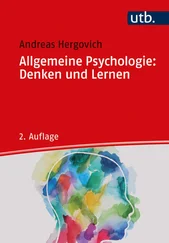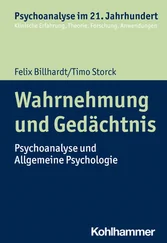Die Psychoanalyse lässt sich durch drei spezifische Aspekte ihrer psychologischen Theorie und damit auch ihres Blicks auf das Denken kennzeichnen: Erstens geht es um dynamisch unbewusste Prozesse, die sich mit Freud zum einen im topischen Modell (Systeme des psychischen Apparates: Bw, Ubw, Vbw), zum anderen im Instanzen-Modell (Ich, Es, Über-Ich) konzeptualisieren lassen. In einem zeitgenössischen Verständnis geht es dabei sowohl auf der Ebene der beteiligten Prozesse (Primär- und Sekundärprozess) als auch auf der Ebene der Vorstellungen als Gegenstände des Denkens um eine Konzeption des Unbewussten, das sich über Verhältnisse in der psychischen Welt bestimmt. Zweitens geht es in spezifisch psychoanalytischer Betrachtung um die konflikthaften Grundlagen der Entwicklung und des Vollzugs psychischer Tätigkeit. Hier lassen sich verschiedene entwicklungspsychologische Spannungsfelder beschreiben, die dazu führen, dass Konflikte mehr oder weniger gut bewältigt werden und zumindest einzelne Aspekte von ihnen abgewehrt und somit unbewusst werden oder bleiben. Drittens kann gesagt werden, dass sich »Denken« in psychoanalytischer Sicht meist auf allgemeinere, weiter gefasste psychische Prozesse bezieht und dass dabei Konzeptualisierungen von Symbolisierung und psychischer Repräsentanzen eine wichtige Rolle einnehmen.
Sandler, J., Holder, A., Dare, C. & Dreher, A. U. (1997). Freuds Modelle der Seele. Eine Einführung. Gießen 2003: Psychosozial.
Storck, T. (2018c). Psychoanalyse nach Sigmund Freud. Stuttgart: Kohlhammer.
Fragen zum weiteren Nachdenken
• Welche unterschiedlichen Konzeptionen unbewusster Prozesse lassen sich in der Psychologie und Psychoanalyse finden?
• Kann es eine konfliktfreie psychische Entwicklung geben bzw. eine solche, in der Konflikte »gelöst« sind und damit verschwinden?
• Welche Bedeutungen bekommen nicht-sprachliche Symbolisierungsprozesse (bildliches Denken, Affektsymbole u. a.) für das Denken?
2Dass Freud philosophische Anschlüsse bei von Hartmann, Schopenhauer oder Nietzsche teilweise benennt, aber nicht wirklich aufgreift, sondern stattdessen viel deutlicher den Anschluss an die Psychophysik Fechners betont, liegt nicht zuletzt in seinem Blick auf die »spekulative« Philosophie begründet, wohingegen er die Psychoanalyse »naturwissenschaftlich« oder medizinisch zu begründen trachtet. Deshalb ist für ihn das Manifest der Helmholtz-Schule, in dem formuliert ist, psychische Vorgänge nach dem Vorbild physikalisch-chemischer Vorgänge zu beschreiben, zentral (vgl. Storck, 2019b, S. 16 ff.).
3Wenn an dieser Stelle von »Mutter« und »Vater« die Rede ist, dann ist dies im Sinne von Beziehungsangeboten zu verstehen, die das Kind in der Welt findet und die in dieser Form oft von den konkreten, gegengeschlechtlichen Elternteilen gemacht werden (vgl. Lang, 2011). »Mutter« meint dabei eine erste Beziehung und Bezugsperson (dyadisch) und »Vater« demgegenüber eine weitere, dazu alternative Beziehung und/oder etwas, auf das die »Mutter« im Erleben des Kindes noch bezogen ist. Die Grundstruktur ist nicht an dichotome Geschlechterrollen, heteronormative Partnerrollen oder klassische Familienstrukturen gebunden, sondern es geht darum, wie das Kind sich mit »Beziehungsflechten« auseinandersetzt.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.