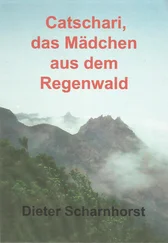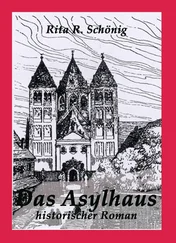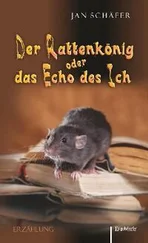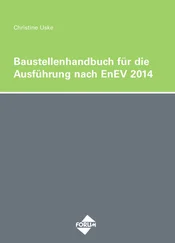Die Einstufung in eine der drei Geotechnischen Kategorien (GK 1 bis GK 3) muss vor Beginn der geotechnischen Untersuchungen erfolgen, ggf. ist diese mit fortschreitendem Kenntnisstand anzupassen.
Die Einstufung hat Auswirkungen auf den Untersuchungsaufwand und ist auch hinsichtlich der Einschaltung eines Sachverständigen für Geotechnik von Bedeutung. So sind z. B. nach DIN 18300 bei Baumaßnahmen der Geotechnischen Kategorie GK 1 die folgenden Angaben zur Beschreibung von Homogenbereichen {Homogenbereiche} (bisher Bodenklassen {Bodenklassen}) ausreichend:
| • |
Bodengruppen nach DIN 18196 |
| • |
Massenanteil Steine, Blöcke und große Blöcke nach DIN EN ISO 14688-1 |
| • |
Konsistenz und Plastizität nach DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte |
Für die Kategorien GK 2 und GK 3 ist hingegeben eine vollständige Beschreibung der Homogenbereiche notwendig.
Ferner ist bei den Geotechnischen Kategorien GK 2 oder GK 3 bereits bei den Leistungsphasen 1 und 2 (Grundlagenermittlung und Vorplanung) der HOAI zwingend ein Sachverständiger für Geotechnik einzuschalten, der die Planung von Bauwerken und Bauteilen im Erd- und Grundbau unterstützt und deren Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit nachweist.
 2.1.3 Planung eines Erkundungsprogramms
2.1.3 Planung eines Erkundungsprogramms
{Erkundungsprogramm}
Voruntersuchungen {Voruntersuchungen}
Vor der Planung eines Untersuchungsprogramms sollten die verfügbaren Informationen und Unterlagen bezüglich der örtlichen Baugrund- und Grundwasserverhältnisse sowie weiterer standortspezifischer Einflüsse in einer Vorstudie bewertet werden.
Beispiele für Informationen und Unterlagen, die benutzt werden können, sind nach DIN EN 1997-2:
| • |
topographische Karten |
| • |
kommunale Karten, die die frühere Nutzung des Geländes beschreiben |
| • |
geologische / ingenieurgeologische Karten und Beschreibungen |
| • |
hydrogeologische Karten und Beschreibungen |
| • |
Luftbilder und frühere Bildauswertungen |
| • |
geophysikalische Untersuchungen aus der Luft |
| • |
frühere Untersuchungen im Planungsbereich und in seiner Umgebung |
| • |
frühere Erfahrungen aus der Gegend |
| • |
örtliche Klimabedingungen |
| • |
Bewertung bestehender Bauwerke, wie Hochbauten, Brücken, Tunnel, Dämme und Böschungen |
| • |
Entwicklungsgeschichte des Planungsbereichs und seiner Umgebung |
Bei größeren Baumaßnahmen werden häufig mehrere Erkundungskampagnen durchgeführt, oft sind auch während der Bauphase Erkundungen bzw. Untersuchungen notwendig. DIN EN 1997-2 unterscheidet hier nach Vor- und Hauptuntersuchungen {Hauptuntersuchungen} sowie baubegleitenden Untersuchungen {Untersuchungen, baubegleitende}.
Erkundungsumfang {Erkundungsumfang}/Abstand von Aufschlüssen {Aufschlüsse, Abstand}
Die aus der Voruntersuchung gewonnenen Erkenntnisse sind durch weitere Baugrunderkundungen zu ergänzen. Hierzu werden Baugrundaufschlüsse (i. d. R. Schürfe und/oder Bohrungen) erstellt. Für den Abstand bzw. das Raster von Aufschlüssen untereinander werden in der DIN EN 1997-2 Richtwerte angegeben:
| Maßnahme |
Abstand der Aufschlüsse |
| Hochbauten, Industriebauten |
Rasterabstand 15–40 m |
| großflächige Bauwerke |
Rasterabstand von nicht mehr als 60 m |
| Linienbauwerke {Linienbauwerke} (z. B. Straßen, Eisenbahnen, Kanäle, Rohrleitungen {Rohrleitungen}, Deiche, Tunnel, Rückhaltedämme) |
Abstand zwischen 20 und 200 m |
| Sonderbauwerke (z. B. Brücken, Schornsteine, Maschinenfundamente) |
2–6 Aufschlüsse je Fundament |
| Staudämme und Wehre |
Abstände zwischen 25 und 75 m in maßgebenden Schnitten |
Tab. 2: Empfehlungen für die Abstände von Aufschlusspunkten (Quelle: DIN EN 1997-2)
Die in der Tabelle angegebenen Abstände sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten festzulegen. Bei schwierigen Baugrundverhältnissen mit stark wechselndem Schichtaufbau sind die Abstände beispielsweise deutlich zu verkleinern.
Erkundungsumfang / Tiefe von Aufschlüssen {Aufschlüsse, Tiefe}
Die Tiefe von Aufschlüssen richtet sich nach dem Bauwerk und den geotechnischen Randbedingungen. Grundsätzlich sollten die Aufschlüsse alle Schichten erfassen, die im Einflussbereich des Bauwerks liegen. Dies umfasst den Baugrund im Bereich der Gründung bzw. innerhalb des Lastabtragungsbereichs unterhalb der Gründungssohle. Bei Hanganschnitten und Stützbauwerken sind auch die Bereiche möglicher Gleitflächen zu erfassen. Bei Bauwerken, die ins Grundwasser einbinden oder auch bei Dämmen und Wehren sind die hydrogeologischen Verhältnisse zu beachten. Hierzu sind i. d. R. die entsprechenden Kennwerte bis in eine Tiefe zu ermitteln, in der es durch das Bauwerk oder eine GW-Haltung zu einer Änderung der Strömungsverhältnisse kommt.
In DIN EN 1997-2 sind für Hochbauten, Ingenieurbauwerke, Erdbauwerke, Linienbauwerke {Linienbauwerke}, Hohlraumbauten {Hohlraumbauten}, Baugruben, Dichtungswände und Pfähle entsprechende Aufschlusstiefen {Aufschlusstiefe} {Aufschlüsse, Tiefe} za genannt, bei denen die o. g. Vorgaben i. d. R. erfüllt sind (Tab. 3). Bei den dargestellten Skizzen (Bild 1) ist zu beachten, dass sich die Aufschlusstiefe za dabei jeweils auf die Unterkante des Bauwerks bzw. des Bauteils bezieht. Die tatsächliche Aufschlusstiefe der i. d. R. von der Geländeoberfläche ausgeführten Aufschlussbohrungen oder Sondierungen ist daher meist größer als der angegeben Wert za.
Bei zwei Angaben für za ist der jeweils größere Wert maßgebend.
| Bauwerk |
Aufschlusstiefe za 1) 2) |
| Hoch und Ingenieurbauten |
|
| Fundamente |
za ≥ 3,0 ∙ bf,za ≥ 6 m |
mit bf = kleinste Fundamentbreite |
| Plattengründung |
za ≥ 1,5 ∙ bB |
mit bB = kleinste Bauwerksseitenlänge |
| Damm |
0,8 ∙ h < za < 1,2 ∙ hza ≥ 6 m |
mit h = Dammhöhe |
| Einschnitt |
za ≥ 0,4 hza ≥ 2 m |
mit h = Einschnitttiefe |
| Linienbauwerke |
|
| Straßen und Flugplätze |
za ≥ 2 m |
unter die vorgesehene Aushubsohle |
| Gräben {Gräben} und Rohrleitungen {Rohrleitungen} |
za ≥ 2 mza ≥ 1,5 ∙ bAh |
unter die vorgesehene Aushubsohlemit bAh = Breite des Aushubs |
| Baugruben |
|
| GW-Spiegel/-druckfläche unterhalb Baugrubensohle |
za ≥ 0,4 ∙ hza ≥ (t + 2,0) m |
mit h = Baugrubentiefemit t = Einbindetiefe |
| GW-Spiegel/-druckfläche oberhalb Baugrubensohle |
za ≥ (1,0 ∙ H + 2,0) m |
mit H = Höhe der GW-Oberfläche über der Baugrubensohle |
| za ≥ (t + 2,0) m |
mit t = Einbindetiefe bzw. |
| za ≥ (t + 5,0) m |
wenn kein GW-Hemmer bis zu dieser Tiefe erreicht wird |
| Pfähle {Pfähle} |
za ≥ 1,0 ∙ bg |
mit bg = kleinste Länge eines Rechtecks, das eine Pfahlgruppe in Fußebene umschließt |
| za ≥ 5,0 m |
|
| za ≥ 3,0 ∙ DF |
mit DF = Pfahlfußdurchmesser |
| 1)Die tatsächliche Aufschlusstiefe ist meist größer als der angegebene Wert za, da meist noch die Tiefe zwischen Geländeoberfläche und Gründungsebene hinzu gerechnet werden muss.2)Bei zwei oder mehr Angaben für za ist der jeweils größere Wert maßgebend. |
Tab. 3: Richtwerte für die erforderliche Aufschlusstiefe (Quelle: DIN EN 1997-2)
Читать дальше
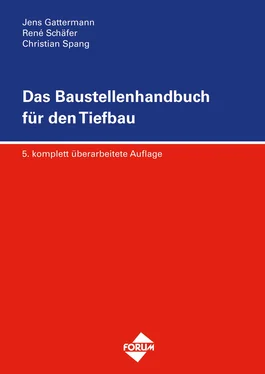
 2.1.3 Planung eines Erkundungsprogramms
2.1.3 Planung eines Erkundungsprogramms