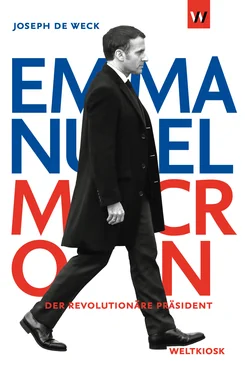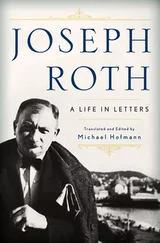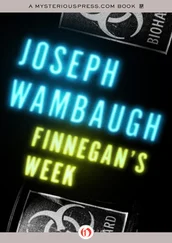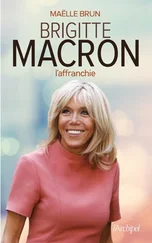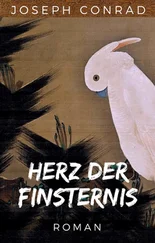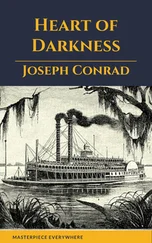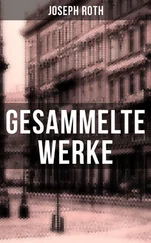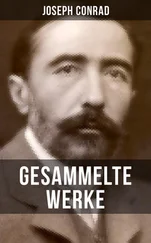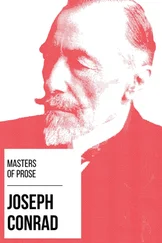Zugleich erstaunt, dass ein ganz anderes Bild entsteht, sobald man Französinnen und Franzosen nach der Zufriedenheit mit ihrem Einkommen oder ihrem Arbeitsplatz befragt. Im Sommer 2020 sagten 85 Prozent, sie seien zufrieden mit ihrem Job; lediglich 8 Prozent rechneten damit, dass sich ihre Situation in den kommenden zwölf Monaten verschlechtern werde. Diese Umfragewerte sind praktisch identisch mit denen aus Deutschland.
An der Forschung von Senik fällt ein weiterer Punkt auf. Auch im Ausland lebende Franzosen sind weniger zufrieden mit ihrem Leben als die Bevölkerung im Gastland und andere dort lebende Ausländer. Umgekehrt werden Zuzügler nach Frankreich mit der Zeit ähnlich verzagt wie die Einheimischen. Frankreichs «kulturelle Mentalität» und die Bildungstradition machten die Franzosen unglücklicher, als ihr materieller Wohlstand suggeriert, erklärt die Glücksprofessorin Senik. «Frankreich ist ein Paradies, das von Menschen bevölkert ist, die sich in der Hölle wähnen», brachte der Schriftsteller Sylvain Tesson dieses Phänomen auf den Punkt.
Woher rührt solche Lust an der Kritik und der Härte gegen sich selbst? «Wenn die Engländerinnen rothaarig sind, so sind die Franzosen Kartesianer», schrieb der Philosoph André Glucksmann 1987 selbstredend klischierend in seinem Buch Descartes, c’est la France . 37« Je pense, donc je suis » («Ich denke, also bin ich») lautet das berühmte Dictum des französischen Mathematikers und Philosophen des 17. Jahrhunderts, René Descartes.
Doch Descartes’ geradliniges Denken hat widersprüchliche Ideen in Frankreichs Wesen eingewoben, so Glucksmann, der 2015 verstorben ist. Zum einen hat es die Begeisterung für den Rationalismus geweckt. Als sich die — vor dem Zeitalter der Aufklärung undenkbare — Möglichkeit einer menschengemachten Welt eröffnete, ebnete dies Frankreichs Weg zur Revolution und zur voluntaristischen, träumerisch-idealistischen Nation. Immer wieder erklärt Emmanuel Macron, Frankreich müsse wieder an diesen «Geist des Wagnisses» (« esprit de conquête ») anknüpfen.
Doch zum anderen beruht Descartes’ Rationalismus auf der Fähigkeit des Menschen, zu zweifeln, etablierte Ordnungen zu hinterfragen und nicht alles zum Nennwert zu nehmen. Die Praxis des Zweifels mag Fortschritt und Veränderung antreiben. Die Skepsis geht aber einher mit einer Haltung des Argwohns. Wenn die Franzosen nicht erst seit dem Internet und Covid-19, sondern seit je eine Affinität zu kruden Verschwörungstheorien hegen, dann auch deswegen, weil das Land eine Misstrauensgesellschaft ist. Auf die Frage «Kann man anderen Menschen vertrauen?» antworten nicht einmal 30 Prozent der Franzosen mit «Ja». In Deutschland liegt der Wert bei fast 45 Prozent. 38Fast durchweg vermuten sie bei Politikern und zumal bei Macron mehr Machiavellismus, als vorhanden ist.
Eine weitere Folge des Je pense, donc je suis ist, dass in Frankreich nur derjenige etwas gilt, der etwas denkt; genau genommen, der sich etwas ausdenkt. Intelligenz samt ihren Insignien wie Bildung, Kultur und Sprache zählen mehr als das verpönte Geld. Deshalb veröffentlicht jeder Pariser, der etwas auf sich hält (böse Zungen würden sagen: eine Tautologie), und zumal jeder ambitionierte Politiker mindestens ein paar Seiten zwischen Pappdeckeln. Ein Buch belegt, dass man schreiben kann, und im besten Fall, dass man etwas zu sagen hat, das über einen Tweet hinausgeht.
(Es gibt natürlich in Paris eine florierende Industrie von Ghostwritern. Während sich das Deutsche für diese Berufsbezeichnung eines Anglizismus bedient, hat Frankreich passenderweise eine Vielzahl von Umschreibungen wie « prête plume » oder « écrivain fantôme », was mit «ausgeliehene Feder» oder «Phantomschreiber» zu übersetzen wäre. Die aus dem 18. Jahrhundert stammende Bezeichnung « nègre littéraire » verschwindet dagegen allmählich; sie legt offen, dass die Franzosen genau wussten, dass der von ihnen praktizierte Kolonialismus die Arbeit und die Talente anderer ausbeutete.)
Denken ist nicht unbedingt der Weg zum Glücklichsein. Denken mache traurig, meinte der immerzu von Macron zitierte, 2020 verstorbene Literaturwissenschaftler George Steiner. Aber wenn das viele Nachdenken eine ganze Nation verleitet, Trübsal zu blasen, liegt das auch an dem seltsamen Anpassungsdruck, der in diesem Volk der Individualisten herrscht. Zur Illustration: Wer verspätet zu einem Pariser Abendessen stößt und versucht, sich in die laufende Diskussion einzuklinken, der soll die Faustregel anwenden: Hauptsache, irgendetwas sagen, und im Zweifel etwas Kritisches. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Menschen ohne Meinung. Optimisten stehen unter Generalverdacht, naiv zu sein beziehungsweise irgendetwas nicht kapiert zu haben.
Intelligenz und Denkleistung wird mit dem Bezug einer klaren Position und Kritik «an der Macht» oder an den gerade angeblich herrschenden Diskursen gleichgesetzt. Anna Polonyi vom Paris Institute for Critical Thinking (!) vermutet, der französische Drang zur Kritik rühre aus einer «fundamentalen Angst», als Optimist und mithin als «Verlierer» dazustehen. Glücksforscherin Senik bekräftigt: «Es ist kulturell schlecht angesehen, zu optimistisch zu sein» — was Politiker jedoch sein müssen, einschließlich des Zweckoptimisten Macron. Der Franzose verspüre einen gewissen Stolz und fühle sich überlegen, wenn er eine kritische Distanz zu allem wahre — im Sinne von: «Ich habe mich nicht übers Ohr hauen lassen.» 39Descartes’ Losung ist abgewandelt ein «Ich kritisiere, also bin ich (intelligent)».
Bei aller Liebe zum Leiden verwundert es nicht, dass Paris schon immer ein Zufluchtsort derjenigen war, die das Rotweinglas halb leer sehen. Die Stadt war die zweite Heimat des Rumänen Emil Cioran, des schwermütigsten und stilistisch leichtfüßigsten aller Pariser Schriftsteller und Kulturkritiker. Zu seinen Sentenzen gehören Aussagen wie «Wäre Dante Franzose gewesen, er hätte nur das Fegefeuer beschrieben» oder «Ich verstehe Frankreich gut — durch alles, was faul in mir ist». 40
Der im selbstgewählten Pariser Exil lebende Schweizer Schriftsteller Paul Nizon beobachtet: «Frankreich ist ein Land von zweckpessimistischen Individualisten. Sie gehen davon aus, dass das Leben hart ist, und sehen es als ihre Aufgabe, diesem etwas Positives abzuringen.» 41Paradoxerweise dient das negative Welt- und Lebensbild als Quelle der berühmten französischen joie de vivre , der Lebenslust. Das Schöne muss zelebriert, jede gute Nachricht mit Champagner gefeiert werden, denn frohgemute Erlebnisse werden als Ausnahmefälle betrachtet.
Das Bild des unzufriedenen Franzosen ist natürlich vor allem auch eine Pariser Impression. Im Süden des Landes ist man ausgeglichener, im Westen geschäftiger, im Osten gemütlicher. Aber wo auch immer im Lande, der Gutgläubige kommt in der französischen Kulturgeschichte schlecht weg. Jeder Jugendliche liest in der Schule Voltaires Candide oder der Optimismus , in dem sich der Nationalautor dauernd über die Naivität und den Optimismus der Hauptperson seiner Novelle mokiert. Versöhnlich gestimmte Autoren werden in die Gattung livres de plage (Strandbücher) einsortiert: eine schöne Ablenkung beim Sonnenbaden an der Küste, keine ernsthafte Literatur.
Pessimismus und Kritik sind nicht bloß ein Beiwerk der intellektuellen Eitelkeit; sie erlauben es den Franzosen auch, Nähe herzustellen und Solidarität mit weniger Glücklicheren zu zeigen, meint Polonyi. Wer im Gespräch mit anderen Kritik übe, sei es am Wetter, sei es am Staat, sei es am Nachbarn, der im Treppenhaus nicht mal « bonjour » zugerufen habe, gebe sich als vulnerabel zu erkennen.
Bereits die Begrüßung ist der Auftakt eines Klagelieds. Man fragt leicht besorgt « ça va? » und erwartet durchaus ein Seufzen oder Lamento — während in Deutschland und erst recht in Großbritannien auf ein «Wie geht’s?» das obligate, unverbindliche «gut» folgt und jede andere Antwort irritieren würde. So ist das französische «Ach und Weh» ein Türöffner für Komplizenschaft in diesem Land, in dem der erste Kontakt oft distanziert oder unbeholfen ist. Eine gemeinsam erlittene Misere wirkt als einigende Kraft.
Читать дальше