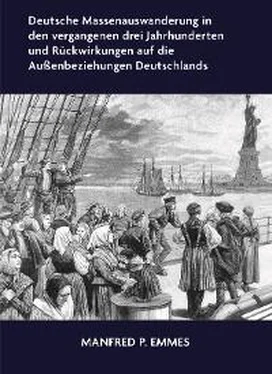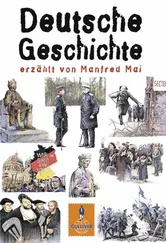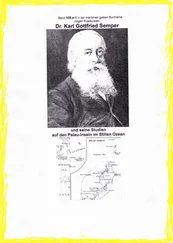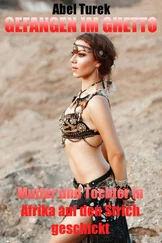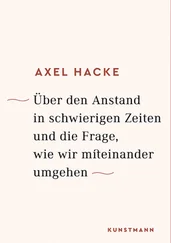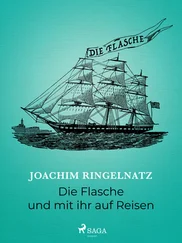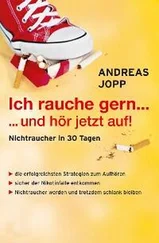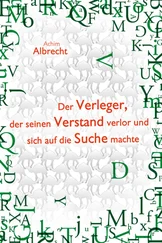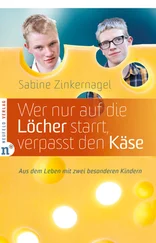Das so umrissene Nord- und Südamerikabild und die hohe Glaubwürdigkeit ausstrahlenden Auswandererbriefe waren nicht nur wichtig für den Auswanderungsentschluss, sondern auch für die weitergehende Entscheidung über das Auswanderungsziel. Die Mehrheit der deutschen Auswanderer kam keineswegs orientierungslos und isoliert in einem für sie unbekannten Nord- und Südamerika an. Oft reisten die Auswanderer in Gruppen und trafen am gewählten Siedlungsort in der Regel bereits auf dort ansässige Deutsche.
Vielfach begannen die Auswanderungen somit als Kettenwanderungen, die gewissermaßen ihren eigenen Spuren folgten. Bald schon begründeten sie feste überseeische Wanderungstraditionen, die bestimmte Regionen und sogar Gemeinden mit anderen in der Neuen Welt in Kontakt brachten. Bei Kettenwanderungen hatte dies zudem den Vorteil, dass es für Auswanderungswillige gesicherte Informationen nicht nur über die Lebenswelt im Aufnahmegebiet, sondern auch wichtige Hinweise auf die günstigsten Transportmöglichkeiten und Reiserouten zum Zielort gab; häufig waren dort bereits Anlaufstellen vorhanden und Unterkünfte sowie Arbeitsplätze bereitgestellt. Eine feste Praxis der Wanderungsaktivitäten konnte sogar dazu führen, dass in den Herkunftsregionen die transatlantische Migration auch Jahrzehnte nach ihrem Beginn weiterhin auf hohem Niveau blieb. Dieses Verhaltensmuster wurde selbst dann noch beibehalten, wenn die sozial-ökonomische Lage, die die erste Phase in der Entwicklung einer Wanderungstradition maßgeblich begründet hatte, sich in der Folgezeit völlig verändert hatte. Häufig erfolgte dies somit noch in Perioden, in denen es im Ausgangsraum bereits wieder genügend landwirtschaftliche oder industrielle Erwerbsangebote gab. Letztendlich zeigt dies die weitreichenden und z. T. sich verdichtenden Wechselwirkungen der Prozesse von Abwanderung und Neuansiedlung in längeren Zeiträumen. Die hierbei im Einzelnen oft festzustellenden, vielfältigen Rück- und Sachbezüge und die sie bedingenden Faktoren sind zwar aufschlussreich, können im Rahmen dieser knapp angelegten Darstellung indes nicht vertieft, sondern im jeweiligen Themenbogen meist nur angedeutet werden. Gleichwohl soll ein möglichst differenziertes Bild der nicht immer emotionsfreien Gesamtthematik gezeichnet werden.
Bezüglich der Verwendung der Begriffe „Auswanderung“ und „Emigration“, die häufig synonym verwendet werden, wird darauf hingewiesen, dass hierbei doch ein deutlicher Unterschied zwischen beiden besteht. Die Auswanderung erfolgt freiwillig, während unter Emigration ein unfreiwilliges Verlassen der Heimat verstanden wird. Emigration ist somit das Ergebnis direkter oder indirekter, politischer, sozialer, religiöser oder ökonomischer Verfolgung oder Ächtung. Der Begriff „Migration“ hingegen wird in der Bedeutung einer langfristigen Änderung des Wohnorts verwendet. 1
Im Vordergrund dieser Studie stehen daher nicht die (kontinentalen) Binnenwanderungen, die ebenfalls von erheblicher Bedeutung waren, sondern die - in übergreifende historisch-politische Zusammenhänge einzuordnende - deutsche Massenauswanderung im 19. und 20. Jahrhundert, vornehmlich nach Übersee. Die Migrationsströme haben diesem Zeitraum einen prägnanten Stempel aufgedrückt und auch deutlich gemacht, dass die Bewegung von Menschen über Staatsgrenzen und die Begegnung ihrer Kulturen nicht Ausnahme, sondern Regel waren. Insofern sollen weniger die binnenpolitischen und -wirtschaftlichen Auswirkungen dieser internationalen Auswanderungsströme beleuchtet, sondern vielmehr ihre weitergehende Ausstrahlung auf die jeweils bilateralen Beziehungen Deutschlands zu den transkontinentalen Haupteinwanderungsländern skizziert werden.
Auswandern - so wie es heute in Deutschland nahezu problemlos möglich ist - war in früheren Zeiten nicht per se eine unbeschränkte Option, noch bestand ein rechtlicher Anspruch hierauf. Insoweit lässt sich seit dem Spätmittelalter eine bestimmte Entwicklungsgeschichte zu mehr Liberalität der Migration in deutschen Ländern nachverfolgen. Dass ein Land seine Bewohner oft nicht freiwillig fortziehen ließ und die Auswanderung zuweilen stark behinderte oder nahezu unmöglich machte, ist aus der jeweiligen Sozialstruktur, dem wirtschaftlichen Verlust von Arbeitskraft sowie Kapital und bei Männern auch des „soldatischen Werts“ seiner Bewohner nachvollziehbar. Der Wegzug eines produktiven Bevölkerungsteils bedeutete offenkundig und häufig einen „Aderlass“ für die jeweiligen Gebiete. So versuchten die Behörden nicht selten und auf vielerlei Weise, den (Werbe-) Einflüssen von außen entgegenzuwirken, die starke Anreize für die Auswanderung bildeten. 2
Den frühen und verschiedenen Auswandererwellen seit dem 18. Jahrhundert kann hier weder zeitlich noch räumlich vertieft nachgegangen werden. Im Zentrum der Studie stehen die großen deutschen Auswandererströme nach Nord- und Südamerika sowie eingeschränkt nach Russland, insbesondere während des 19. Jahrhunderts. Bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts setzte sich die deutsche Auswanderung aus einer Reihe einzelner, eher sporadisch auftretenden Wellenbewegungen zusammen, während die Massenauswanderung im 19. Jahrhundert eher kontinuierlich verlief und selten starke Rückgänge zu verzeichnen hatte. 3
II. Große deutsche Auswanderungswellen nach Osteuropa und Übersee
1.Auswanderungsfreiheit als Ergebnis langjährigen Liberalisierungsprozesses
Die Auswanderungsfreiheit war Ergebnis einer langjährigen Entwicklung; in früheren Epochen bestand sie nicht unbegrenzt. Noch im 18. Jahrhundert war der Entschluss, aus deutschen Staaten auszuwandern, nicht leicht zu realisieren. Die regierungsamtlichen Standpunkte waren grundsätzlich auswanderungsfeindlich. Im 16. und 17. Jahrhundert galt es als ein wesentliches Hoheitsrecht der Regierungen deutscher Länder, die Bürger unbedingt im Staat zu halten. Jeder Bewohner des Staates wurde von der Regierung als ein dem Staatswesen auf Lebenszeit verpflichteter Bestandteil angesehen, dessen Eigentum, Kreativität, Arbeits- und Steuerkraft sowie Wehrfähigkeit man nicht entbehren zu können glaubte. Ein hartes Auswanderungsverbot erließ z. B. Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz 1752, wo eine geringe Bevölkerung von nur etwa 300.000 Personen die im 17. Jahrhundert erfolgten gewaltsamen Ereignisse und schweren Schäden des Landes überlebt hatte. Zum Auswandern bedurfte es also einer besonderen Erlaubnis, und in den kleinsten Territorien des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation versuchte man, die Bewohner möglichst - auch seitens der Kirchengemeinschaften -vom Auswandern abzuhalten. Letztendlich stellten die Bewohner ein für die Fortentwicklung des Landes wichtiges wirtschaftliches Gut und die Männer überdies ein soldatisches Potenzial dar, auf das man als Landesherr nicht leichtfertig verzichten wollte. Insofern gab es Bestimmungen, die jedem Auswanderer ein hohes Abzugsgeld (Nachsteuer, Freigeld), ein Zehntel seines Gesamtvermögens und mehr auferlegten. Dieser Abgabenzwang stellte eine Entschädigung für den Verlust an Arbeitskräften und das aus dem Lande zu verbringende Vermögen dar und wurde in den 1830er und 1840er Jahren auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen sowie später durch eine deutsche Bundesakte aufgehoben. So konnte z. T. der Hofoder Gutsverkauf von Auswanderungswilligen von der jeweiligen Regierung (Bayern 1764) als nichtig erklärt werden. Die Entlassungen aus dem Untertanenverband und der sogenannten Manumission, d. h. der Freilassung aus der Leibeigenschaft, wurden nicht einfach erteilt. Auf die heimliche Auswanderung standen hohe Strafandrohungen, meist Vermögenskonfiskation, in Frankreich, dem klassischen Land des Merkantilismus, außerdem sogar Galeerenstrafen. Dass all dies notwendig war, zeigten die vielen landesherrlichen Edikte über diese Thematik. Auch versuchten die staatlichen Stellen, die Auswanderung dadurch zu erschweren, dass den Auswanderern aus anderen Reichsgebieten der Durchzug versperrt wurde oder die Untertanen strikte Anweisung erhielten, solchen Auswanderern Fahrdienste, Unterkunft und Verpflegung zu verweigern.
Читать дальше