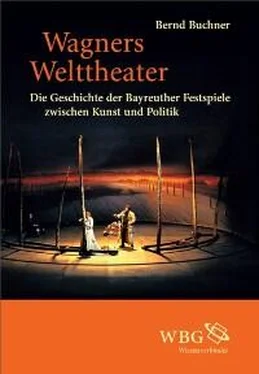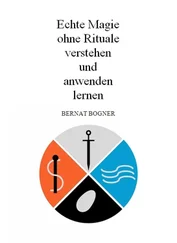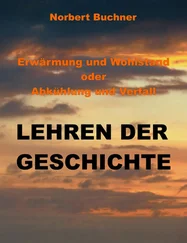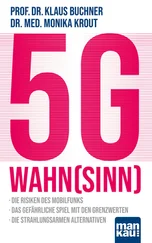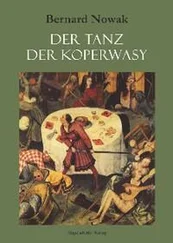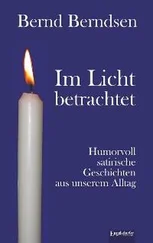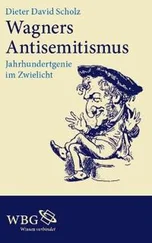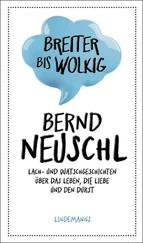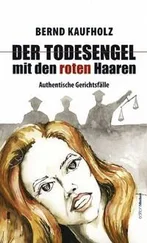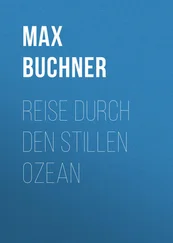Dann wieder schien Wagner mit Bayreuth ganz abgeschlossen zu haben. In einem Brief an Feustel vom Juni des Jahres nannte er als „Grund der eingetretenen Kälte gegen mein Unternehmen“, dass die Zuschauer nicht in die oberfränkische Stadt zurückkehren wollten. Dem Ort selbst, so Wagner, könne er „nur insofern die Schuld geben, als – ich ihn gewählt habe. Doch hatte ich einen großen Gedanken dabei: ich wollte mit Unterstützung der Nation eine durchaus selbständige neue Schöpfung an einem Orte, der erst durch diese Schöpfung zu Bedeutung kommen sollte – eine Art Kunst-Washington.“247 Wagner dachte hier nicht zufällig an die Stadt am Fuße der Apalachen, die ab 1792 als Hauptstadt der USA planmäßig gebaut wurde. Er trug sich mit Plänen, samt Familie und Festspielen nach Amerika auszuwandern. Ludwig II. versuchte, ihn davon abzubringen. Er möge diesem „entsetzlichen Gedanken“ keinen Raum mehr geben, „eine nie zu tilgende Schmach wäre es für alle Deutsche, wenn sie ihren größten Geist aus ihrer Mitte scheiden ließen“. Der Komponist antwortete: „Schon jetzt sehe ich nicht ein, wie ich den Forderungen meiner Festspiel-Gläubiger anders entsprechen soll, als durch einen gänzlichen Abbruch meiner letzten Ansiedelung in Bayreuth“.248 Der Hinweis auf die finanzielle Malaise deutet an, dass Wagner die Pläne auch als Drohpotential einzusetzen wusste. Am Ende war die Hochschätzung des Komponisten für die Vereinigten Staaten, die mit dem beständigen Fernweh eines unruhigen Geistes verknüpf war, dann doch nicht so groß, um die Pläne endgültig ins Auge zu fassen. Im Rückblick auf die Bühnenfestspiele des Jahres 1876 , zwei Jahre danach veröffentlicht, klingt alles Wehklagen über die Situation deutlich gemäßigter.249 Er zeigte sich geschmeichelt über den gesellschaftlichen Erfolg des Unternehmens: „Es schien sehr wahrhaftig, dass so noch nie ein Künstler geehrt worden sei; denn hatte man erlebt, dass ein solcher zu Kaiser und Fürsten berufen worden war, so konnte niemand sich erinnern, dass je Kaiser und Fürsten zu ihm gekommen seien.“ Getäuscht sah er sich allerdings in seiner Annahme, durch die Festspiele „auch ein nationales Interesse geweckt zu haben“. Der frustrierte Wagner erging sich später immer wieder in heftigen Vorwürfen gegen die neue Heimat. Nach der glanzvollen Uraufführung des Parsifal 1882 hält Cosima fest: „Abends bricht R. in bittere Klage über Bayreuth aus, dass ihm niemand gefolgt wäre und sich hier angesiedelt, und dass der Ort auch nicht das mindeste Verständnis ihm entgegengebracht hätte“.250
„Weltabschiedswerk“ und Weltabschied
Enttäuschung, Depression, Flucht- und Auswanderungsgedanken: Wagner litt nach 1876 offenbar auch am Verlust einer Naherwartung, ähnlich wie es die ersten Christen empfunden haben müssen, als die Wiederkunft des Messias ausblieb. „Zwischen Idee und Wirklichkeit“, zitiert Frederic Spotts in seiner Festspielgeschichte den US-amerikanischen Dichter T. S. Eliot, „zwischen Antrieb und Tat fällt der Schatten.“251 Der Komponist musste einsehen, dass sich seine Pläne nicht so hatten verwirklichen lassen, wie er es sich erträumt hatte. Seine Festspielidee war unzureichend umgesetzt. „Bayreuth“, so Udo Bermbach, „war für Wagner von allem Anfang an eine gesellschaftspolitische Aufgabe, nicht irgendein Festspielhaus, sondern ein Ort, an dem sich die revolutionäre Erneuerung der Gesellschaft ein Stück weit vollziehen sollte.“252 Wagners Enkel Beidler sieht in der mangelhaften Verwirklichung der künstlerischen Ideale schlicht „Resignation“ und den Verzicht auf die tragenden, der revolutionären Gedankenwelt von 1848 entstammenden Teile des Festspielgedankens.253 Dies lässt sich auch differenzierter sehen. Wagners eigene Vorstellungen hätten sich mit den Jahren je nach den Umständen geändert, konstatiert Bermbach, „bis sie am Ende mit der Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses in Lage, Architektur und Aufführungspraxis an die frühen revolutionsinspirierten Vorstellungen der fünfziger Jahre erneut anknüpften, hinsichtlich der Finanzierung und der sozialen Zusammensetzung des Publikums sich aber weit davon entfernt hatten“.254 Gerade die Bayreuther Besucher, die Wagner mit „Volk“ und „Nation“ gleichsetzte, zeigten ihm sein Scheitern an: „Es war ein, von den Künstlern abgesehen, eher politisch konservativ eingestelltes Publikum, das an einem nationalen Ereignis teilhaben und einem Künstler mit revolutionärer Vergangenheit nahe sein wollte, der befreundet war mit einem verrückten König, ein Ehebrecher und Schuldenmacher, der den Staat und die Gesellschaft seiner Zeit herausgefordert und sich am Ende doch gegen alle Widerstände mit seinen Plänen durchgesetzt hatte.“255 Dennoch zählte für Wagner letztlich die bloße Verwirklichung seiner Idee mehr als alle verwässernden Modifikationen. Lore Lucas sieht in dem Komponisten eine Mischung aus Durchsetzungsvermögen und Anpassungsfähigkeit: „Ohne ein solches Maß von Selbstbewusstsein, unermüdlicher Werbung in eigener Kunst, Kaltblütigkeit im Planen wie in materiellen Belangen, ohne jenes Maß von Opportunismus wäre Bayreuth als Erfüllung des Festspielgedankens weder denkbar gewesen noch möglich geworden.“256
Wagners desperate Haltung gegenüber Reich und Deutschland war schon vor den ersten Festspielen deutlich erkennbar. Seine „zunehmende Verkrampfung“ (Winfried Schüler)257 seit der Reichsgründung sollte sich später bei den Bayreuther Jüngern zum Dogma verengen. Als ihm Plüddemann 1875 in Berlin sagte: „Die Deutschen haben Sie im Stich gelassen“, antwortete er: „Es gibt keine Deutschen, wenigstens sind sie keine Nation mehr; wer dies dennoch meint und sich auf ihren Nationalstolz verlässt, wird zum Narren.“258 Die Querelen um die Finanzierung der Festspiele und deren künstlerischen Rang, aber auch die Bayreuther Verbürgerlichung hatten dem Künstler offenbar nicht gutgetan. Die Euphorie war künstlich, die Depression echt. Deren Ausdruck war auch eine politische Radikalisierung. Zeugnis davon gibt die 1878 erfolgte Gründung der Bayreuther Blätter , die später wesentlich zur weltanschaulichen Ausprägung des Grünen Hügels beitragen sollten. Wagner erschien die völkisch und antisemitisch gestimmte Zeitschrift als zukunftsweisendes Projekt, als politisches Zentralorgan der Festspiele. Schon in einer der ersten Ausgaben schrieb Constantin Frantz auf seinen Wunsch hin einen offenen Brief als Antwort auf dessen Frage „Was ist deutsch?“ Darin stellte der Preußenhasser Frantz die ehrwürdige Tradition des alten Reiches dem banal-realpolitischen Machtstaat bismarckischer Prägung gegenüber. Deutschland müsse wegen seiner Mittellage dem Gesetz des Ausgleichs und damit dem Föderalismus dienen. Die „wahre deutsche Politik“, die Metapolitik, werde „der deutschen Kunst auch erst die rechte Stätte bereiten, wie andererseits die Kunst die Politik beflügeln wird zu immer höherem Aufschwung“.259 Die von Bayreuth bestellte antipreußische Philippika fiel zu allem Unglück mit einem Attentat auf den Kaiser zusammen und sorgte in dem aufgeheizten politischen Klima für heftige Proteste auch unter Wagnerianern. Zahlreiche Mitglieder des Berliner Wagner-Vereins traten nach Erscheinen des Beitrags aus.260 Der Komponist selbst äußerte sich kaum weniger scharf als Frantz, wenn auch nicht öffentlich: „So schnell haben es sich allerdings wohl nur wenige gedacht, dass die Öde des preußischen Staatsgedankens uns als deutsche Reichsweisheit aufgedrängt werden sollte!“261
Politisch-ideologische Radikalisierung und die sogenannte Regeneration, der Hauptbegriff der Bayreuther Ideologie, gingen in Wagners letzten Jahren Hand in Hand. Unter Regeneration verstand er eine rassisch-biologische Erneuerung der Menschheit. In Heldentum und Christentum lehnte er zunächst eine „Erreichung voller Gleichheit“ entschieden ab, eine klare Rücknahme seiner frühen Forderungen.262 Ebenso heftig wandte er sich gegen Demokratie und Parlamentarismus. Auch sein Antisemitismus verschärfte sich und wurde durch die Bekanntschaft mit dem Schriftsteller Joseph Arthur de Gobineau (1816–1882) zunehmend rassistisch aufgeladen. Im Dezember 1877 beklagte sich Wagner über die „Großzüchtung des Judentums im deutschen Volksleibe“, die Bismarck nicht verhindert habe; ferner über das „unsägliche Elend“, das die Juden über das deutsche Volk gebracht hätten.263 Auf Deutschland allerdings wollte er später auch nichts mehr geben, während er sich in Politikverachtung erging, wie seine Frau in ihrem Tagebuch vermerkte: „[E]r würde sich nie mehr entschließen können, ein Wort über Politik zu sagen“.264 Derlei Bemerkungen meinte Wagner freilich nie ganz ernst, oder in „heftigem Scherz“, wie Cosima sich auszudrücken pflegte. Selbst dem verhassten Sozialismus, dem Bismarck die Schranken aufzuweisen versuchte, konnte der Komponist in dieser Weise Sympathie bekunden. Die Führer der Bewegung, äußerte er laut Cosima, seien gewiss konfuse Menschen „und vielleicht auch intrigante, der Bewegung selbst aber gehört die Zukunft, umso mehr, als wir nichts wissen, um sie aufzuhalten, als törichte Repressionsmaßregeln“.265 Zwei Jahre später hält Wagners Frau fest: „R. sagt, er habe gegen die Commune, bei welcher gewiss sehr rechtschaffende Wesen gewesen wären, das Kindische derselben einzuwenden, zu glauben, dass die Macht des Besitzes, die seit Kain und Abel bestünde, auf diese Weise zu erschüttern sei.“266 Ob Scherz oder altersdepressiver Ernst, ist beim späten Wagner schwer zu unterscheiden. Er glaube nicht mehr an „unsere Musik“, schreibt er 1882 an den Wormser Fabrikanten und engen Wahnfriedfreund Friedrich von Schön (1849–1940), und „sollte unseres Freundes, des Grafen Gobineau Prophezeiung, dass in zehn Jahren Europa von asiatischen Horden überschwemmt und unsere ganze Zivilisation nebst Kultur zerstört werden möchte, in Erfüllung gehen, so würde ich mit keinem Auge zucken, da ich annehmen dürfte, dass dabei vor allen Dingen auch unser Musiktreiben zugrunde gehen würde“.267
Читать дальше