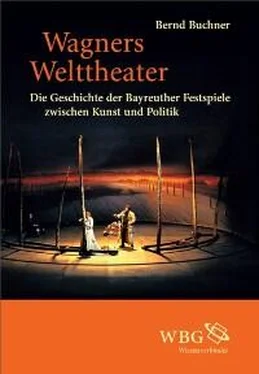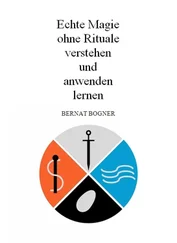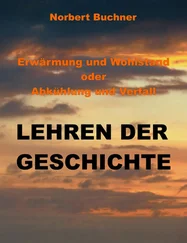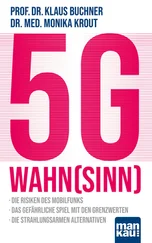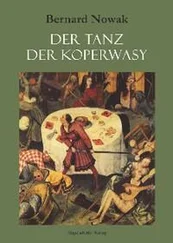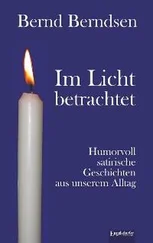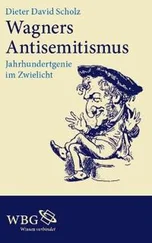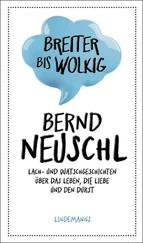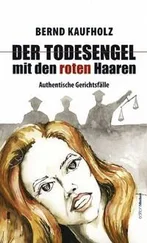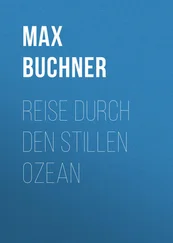Auf Widerspruch stießen die ersten Festspiele vielmehr seitens der evangelischen Kirche, die sich durch Wagners pseudoreligiöse Kunstideologie in ihrer weltanschaulichen Vormachtstellung im preußisch dominierten Reich herausgefordert sehen musste. Der Theologieprofessor Hermann Messner schrieb in der Neuen Evangelischen Kirchenzeitung , das Spiel zu Bayreuth sei „keine Aufführung, sondern ein Kultus; die Fürsten und Fürstinnen, Staatsmänner und Gelehrte u. s. w., welche unter dem Antrieb einer künstlerischen Großtat dorthin zusammengeströmt oder unter dem Eindruck einer nationalen Großtat dorthin gezogen sind, sollten der Offenbarung einer Art von neuer Religion beiwohnen.“ Jeder Verständige müsse verneinen, dass „eine solche Dichtung als ein nationales Heiligtum angesehen werden könne“, setzt der Gelehrte nach und bilanziert: „Sollten wir in einem Worte den Charakter dieser musikalisch-dramatischen Leistung schildern, so würden wir sagen: Sie ist, aus dem pantheistisch-materialistischen Zeitgeiste geboren, die sonderbare Erscheinung eines heidnischen Romantizismus, gerade so überspannt, gerade so sinnlich, wie die ausgestorbene Romantik unserer Literatur, nur anstatt auf das Mittelalter und den Katholizismus hingewandt auf die vorchristliche Zeit und das Heidentum.“232
Vom Standpunkt der kirchlichen Autorität hingegen dürfte den protestantischen Bayreuthpilgern das Erlebnis von 1876 gefallen haben, denn in den Reihen der Wagnerianer fanden sie obrigkeitstreues Verhalten im preußischen Sinne vor. Einem wachen Geist wie Paul Lindau, von Wagners Parteigängern als Beispiel „bösen und zersetzenden Wesens“233 gebrandmarkt, fiel dies unangenehm auf: „Es kommt mir so vor, als sei die gute alte Zeit des beschränkten Untertanenverstandes wiedergekommen (…). Die Rechte des Bayreuther Festspielbesuchers sind ungefähr dieselben, wie die des Untertanen im alten Preußen, die in den beiden Worten wiedergegeben waren: ‚Steuern zahlen‘, ‚Maulhalten‘.“234 Dies bot einen gewissen Gegensatz zum Inhalt der Ring -Tetralogie, die samt Vertragsbruch, Inzest, Ehebruch und Mord „so ziemlich gegen alle Gebote unseres Strafgesetzes verstoße“, wie sich Lindau von einem juristisch bewanderten Festspielgast erläutern ließ. Verwundert zeigte er sich, dass er neben den Kaisern und Fürsten keine aktiven Politiker im Bayreuther Publikum fand. „Ich habe, außer Franz Duncker, noch nicht einen einzigen Träger eines politischen Namens von Bedeutung erblickt.“235 Lindau, Berichterstatter der Schlesischen Presse , zog trotz seiner kritischironischen Distanz zu dem Unternehmen am Ende ein anerkennendes Fazit: „Wagner hat erreicht, was noch kein Künstler vor ihm auch nur anzustreben sich vermessen hatte. Bayreuth – wie wir die Summe all’‘ dieser Anstrengungen und Resultate mit einem Worte bezeichnen wollen – Bayreuth ist zwar kein ‚nationales Unternehmen‘; es ist in seinem eminent persönlichen Charakter sogar die volle Negierung des Nationalen. Aber unzweifelhaft ist es die stärkste individuelle Leistung, die zu denken ist. Dem entsprechend ist auch der Lohn ein ganz ungewöhnlicher, nie dagewesener. Hier hat nun der Künstler auf dem Fleck Erde, den er selbst bestimmt, ein selbstgebautes Theater, mit Einrichtungen, die er selbst getroffen, mit einem Orchester, das er selbst geworben – einem Orchester, das beiläufig bemerkt, künstlerisch vollkommen ist – hier hat er Künstler seiner eigensten Wahl, die er selbst zu seinen Zwecken gebildet und gefördert hat. Reiner und vollständiger haben sich nie die Intentionen eines Künstlers in die Wirklichkeit übertragen lassen. Und was bedeuten dieser stolzen und erhebenden Genugtuung gegenüber alle kleinlichen Ärgernisse! Schönere Stunden, als sie Wagner in den letzten Tagen gegönnt, sind einem Künstler niemals beschieden gewesen.“236
Das war die Außensicht, die Wirklichkeit lag anders. Der Komponist hatte in Bayreuth nicht nur schöne Stunden. Seine Hauptempfindung sei „nie wieder, nie wieder“ gewesen, sagte Wagner wenige Wochen nach Abschluss der Festspiele zu Cosima, als er auf den „traurigen Gegenstand“ zu sprechen kam.237 Mit einem kalten Gefühl der Enttäuschung und der Ungewissheit hatte er das Unternehmen vorerst zum Ende geführt. Am 30. August 1876 sagte er: „Die Bühnenfestspiele sind vorüber; ob sie wiederkehren, weiß ich nicht!“238 Zu einem künstlerischen Resümee sah sich Richard Wagner allenfalls ansatzweise in der Lage, zu einer politischen Bilanz gar nicht, stattdessen fiel er in „Nachgeburtsdepressionen“ (Frederic Spotts)239. Im September notiert Cosima: „R. ist sehr traurig, sagt, er möchte sterben!“240 Beim Anblick des verlassenen Theaters äußerte er einmal: „Wie eine Narrenlaune steht es da“, und über die Festspiele äußerte er: „Das Unzulängliche ist und bleibt der Fluch aller meiner Bestrebungen!“241 Am 21. Oktober schrieb er an den bayerischen König, statt Dankbarkeit für die Festspiele gebe es nichts als Zank ums Defizit.242 Vom Reich komme keine Regung, schuld am finanziellen Desaster sei die Zeitungspresse. Die Festspiele müssten eine freie Stiftung bleiben, „mit dem einzigen Zwecke, zur Begründung und Pflege einer originalen deutschen musikalischdramatischen Kunst als Vorbild zu dienen“. Voraussetzung sei, „dass das Unternehmen selbst nie zu finanziellem Erwerbe diene, und namentlich der oberste Leiter desselben nie eine Entschädigung für seine Bemühungen in Anspruch nehme.“ Wagner schickte dem König zudem einen vorformulierten Antrag zur Unterstützung der Festspiele durch das Reich, den Ludwig II. im Bundesrat einbringen sollte. Vom Kaiser, schreibt der Komponist überdies, könne er sich „ein tieferes Verständnis der Sache auch nicht leicht erwarten“. Faktisch wollte Wagner den bayerischen Monarchen dazu bringen, die Festspiele „dem Reich zu empfehlen oder die Sache ganz zu übernehmen“.243
Vor allem wegen der finanziellen Misere, aber auch wegen der künstlerischen Mängel und der mangelnden politischen Unterstützung spielte der Komponist mit dem Gedanken, sich von dem Bayreuther Unternehmen zu lösen. Entsprechendes ließ er seine publizistischen Paladine verbreiten. Martin Plüddemann forderte das Reich auf, sicher nicht ohne stillschweigende Zustimmung Wagners, die Festspiele gleichsam zu kaufen – er tat das mit präzisen Zahlen und unverblümter antiparlamentarischer Verve: „Wagner braucht eine Million; das Reiche gebe ihm diese oder die Zinsen einer solchen, jährlich 50.000 Taler, als Subvention für sein glanzvolles Unternehmen; die deutsche Kunst und einst die ganze Nation wird es ihm Dank wissen! – Doch begeben wir uns nicht zu weit nach Utopien, vor der Hand ist die Aussicht hierauf gering; unser Reichsoberhaupt zwar, Kaiser Wilhelm, hat seine persönliche Anerkennung für ein derartiges Unternehmen durch Ankauf von 30 Patronatscheinen und Hinterlassung von 20.000 Mark deutlich gezeigt, unser Reichskanzler, der Fürst v. Bismarck, ist ebenfalls ein entschiedener Freund der Sache und Wagners Begünstiger; aber die Zusammensetzung des Reichstages müsste entschieden anders gefärbt sein, ehe er so etwas gutheißen würde. Hat das deutsche Volk aber, in besserer Erkenntnis seiner Interessen, diese Zusammensetzung geändert, dann müsste ein Mann die Sache in die Hand nehmen und ernstlich dafür plädieren. Wird dieser Mann sich finden ?“244 Bei der Patronatsversammlung im September 1877 sprach Wagner davon, „mir langsam die Mittel vorzubereiten, durch welche ich den hiesigen Festspielen eine wirkliche Dauer geben, ihnen ein Ernähren von sich selbst heraus ermöglichen, sie zu einer wirtschaftlichen Schöpfung machen kann“.245 Allerdings hatten sich die Zeiten seither gewandelt, der bayerische Staat war gegenüber dem kapriziösen Komponisten bei weitem nicht mehr so freigebig wie noch ein gutes Jahrzehnt zuvor. Dennoch gediehen die Verhandlungen zwischen dem Haus Wahnfried und den Hofbeamten des Königs wegen einer „Übernahme der Festspiele in Bayreuth seitens der Münchner Intendanz“ im Frühherbst 1877 bis kurz vor Vertragsreife.246
Читать дальше