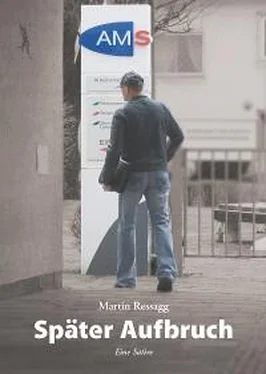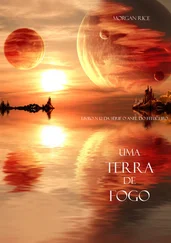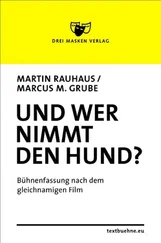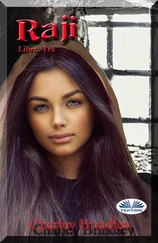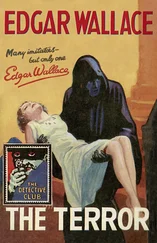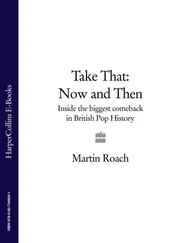üblich, den beteiligten Mitarbeitern irgendwelche Diäten oder Überstunden auszubezahlen, was die Kosten geringfügig senkte. Just in dieser finanziell bedrohlichen Situation flatterte uns eine Rechnung ins Haus: Für wohlfeile 170.000 Euro musste sich die Firma nun eine gebrauchte zweimotorige Cessna kaufen, um die zuvor genannten Bedrohungsbilder hintanzuhalten. Nachdem dieser »Notkauf« nicht geheim gehalten werden konnte, gab es etwas später in einem Meeting folgende Information: Man habe im Sinne der Flexibilität handeln müssen. Es gehe nicht an, dass in 1000 km Entfernung eine Maschine stillstehe und unser Chef müsse erst mühsam mit dem Auto dorthin fahren. Dann aber kam das Eingeständnis, dass Unterbringung, Wartung und Erhaltungskosten für dieses Gerät einen erheblichen Kostenfaktor für ein kleines Familienunternehmen darstellen und man danach trachte, eventuelle »Taxiflüge« für andere Unternehmen durchzuführen, um die Kosten etwas aufteilen zu können. Wenige Tage später stand ich mit einem fertigen Konzept beim Chef: Über die Wirtschaftskammer hätten wir Adressen von Unternehmen erhalten können, welche an dieser Art der Dienstleistung Interesse hätten haben können. Einen Textentwurf für die Aussendung hatte ich vorbereitet, einen Artikel für die »Domländische Wirtschaft« hatte ich ebenso entworfen. Nun zeigte sich aber eine gänzlich andere Situation: »Wir wollen ja nicht Lufttaxi für Hinz und Kunz spielen.« Wenn jemand Interesse daran habe, das Bammer’sche Fluggerät samt Crew zu buchen, so möge derjenige doch bittstellend auf uns zukommen (vorzugsweise natürlich befreundete Unternehmer). Wenn dann die Chemie stimmt und das Bordpersonal nicht gerade anderweitig verplant ist, dann würde man eine derartige Dienstleistung ja gerne durchführen. Ich habe in den darauffolgenden Jahren nicht bewusst erlebt, dass die Firma je als Luftfahrtunternehmen tätig geworden wäre. Dafür habe ich bisweilen Urlaubsfotos von den Perlen der Adria gesehen, die offenbar nicht auf dem Landweg oder per Linienflug erreicht worden waren. Weil in solchen Fällen aber der gute Wille für das Werk steht, wurde offenbar versucht, für viele tausend Liter Flugbenzin vom Finanzamt eine Rückerstattung geleisteter Abgaben zu erlangen, wie sie für Luftfahrtunternehmen anscheinend vorgesehen ist. Ob diesem Ansinnen letztlich stattgegeben wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
Eine ebenso bezeichnende Flugzeug-Episode wurde mir später von Frank berichtet: Ein großer deutscher Kunde war im Begriff, mehrere Maschinenausrüstungen im Wert von weit über 100.000 Euro zu bestellen. Die Endverhandlungen für diesen Auftrag wollte man mit dem Chef persönlich führen, die Außendienstmitarbeiter hatten ja nicht den entsprechenden Handlungsspielraum. Bei den Details wollte der Kunde einige Kleinteile im Wert von wenigen hundert Euro ohne zusätzliche Berechnung für sich heraushandeln. Unser Chef verfiel augenblicklich in eine gejammerte Elegie, das Geschäft sei unerbittlich hart, die Ausrüstungen ohnehin so kalkuliert, dass kein Cent mehr bleibe, kurzum, es sei daher schlicht unmöglich, auch noch diese Kleinteile im Preis zu integrieren. Dabei dürfte er so glaubhaft gewirkt haben, dass der Kunde nur mit Mühe die Tränen zurückhalten konnte und sofort einwilligte, diese Teile separat zu bezahlen. Die Tinte unter dem Kaufvertrag war noch feucht, als der Chef eine Bitte äußerte: Ob es wohl möglich sei, dass sein Begleiter während des im Anschluss geplanten Essens seinen Laptop in den Räumen des Kunden aufladen könne. Man sei nämlich mit dem PRIVAT-FLUGZEUG angereist und müsse für den Rückflug ausreichend Akku-Kapazität sicherstellen. Frank erlangte angesichts dieser plötzlichen Wohlstandskundgebung eine gesunde Gesichtsfarbe, der Chef aber merkte gar nicht, wie unglaubwürdig er von einer Sekunde auf die andere geworden war. Fingerspitzengefühl war also Herrn Bammers Sache nicht.
Anfang Juli waren die »Aufnahmeprüfungen« an der Pädagogischen Hochschule zu absolvieren. Am ersten Tag ging es darum, innerhalb einer kleinen Gruppe von Studenten glaubhaft die Motive für die getroffene Berufswahl zu präsentieren. Dabei wurde jeweils folgender Ablauf gewählt: Von einem Professor wurde kurz das Thema erklärt, welches die Präsentation behandeln sollte. Dann hatte man zehn Minuten Zeit, um sich auf das Thema vorzubereiten, und schließlich sollte das Ergebnis in einer etwa drei Minuten dauernden, möglichst freien Rede dem Publikum übermittelt werden. Meine armen, jungen Mitprüflinge schrieben sich in der zur Verfügung stehenden Zeit fast die Finger wund, um dann – sich krampfhaft an ihren Zettelchen festhaltend – die Stichworte abzulesen und in der verbleibenden Zeit stakkatoartig zu beteuern, wie gut man doch für diesen Beruf geeignet sei und wie viel Freude man denn an Kindern habe. Dazu kam, dass jene gestrenge Professorin, welche uns am ersten Vormittag begleitete, die Stoppfunktion ihres iPhones aktivierte und exakt die Einhaltung der vorgegebenen Redezeit kontrollierte. Ich hatte beschlossen, mir keine Notizen zu machen. Aus etlichen Erfahrungen, die ich in den von mir absolvierten Kursen gemacht hatte, wusste ich, dass es mir möglich wäre, eine dreiminütige Präsentation auch ohne Stichwortzettel zu halten. Nach meinem Ermessen gelang das auch ganz gut.
Die Vorgangsweise blieb die gleiche, als es darum ging, sich für seine fiktiven Schüler ein Schulprojekt auszudenken und dieses dann auf einem fiktiven Elternabend den staunenden Eltern zu präsentieren. Während meine künftigen Kommilitonen Skikurse und gesunde Jause präsentierten, also Projekte, die sie als Schüler soeben noch selbst erlebt hatten, entschloss ich mich, eine fächerübergreifende »Zukunftswoche« an der Schule einzuführen. In dieser Woche sollten die Schüler aufgefordert werden, ihre Vorstellungen von ihrer eigenen Zukunft zu präsentieren, anstatt ein fertiges Konzept der Erwachsenenwelt vorgesetzt zu bekommen. Mit viel Verve präsentierte ich dieses Projekt, sprach neben den fiktiven Eltern auch mein fiktives Kollegium an, schrieb in Riesenlettern an die Tafel und pries den Nutzen, den die ganze Gesellschaft aus einem solchen Projekt ziehen könne. Gott sei Dank hatte inzwischen ein Professorenwechsel stattgefunden, denn die drei Minuten werde ich bei dieser Präsentation wohl nicht ganz eingehalten haben.
Am letzten Prüfungstag war ein Rechtschreibtest angesetzt. Dankenswerterweise hatte jemand in den Hinweisen zur Anmeldung einen Link zu einem ähnlichen Test gesetzt, so konnte ich einige Tage zuvor bereits nachsehen, wie dieser Test so abläuft. Da ich an meinem Rechner die Lautsprecher nicht angeschlossen hatte, bekam ich nicht mit, dass der Test auch akustische Anweisungen gab. So wunderte ich mich sehr, dass ich beim Ausfüllen von Leerfeldern, für welche mehrere Begriffe möglich waren, immer null Punkte bekam. Erst später bemerkte ich, dass hier genau jene Wörter zu ergänzen waren, welche eine sonore elektronische Stimme vorgab. Bei meinem ersten Testlauf hatte ich etwa 85 %, damit war ich einigermaßen zufrieden. Am Vorabend des Rechtschreibtests entschloss ich mich, den Beispieltest nochmals zu absolvieren, dabei hatte ich die Lautsprecher angeschlossen. Mit einer Quote von diesmal 93 % war ich durchaus zufrieden und ging am nächsten Tag voller Zuversicht zum Test. Die gnädigen Professoren und der Computer dürften meine Leistungen allesamt recht positiv beurteilt haben. Als etwa eine Woche später die Ergebnisse veröffentlicht wurden, stellte sich Folgendes heraus: Von etwa 140 Bewerbern konnten insgesamt 110 die Aufnahmeprüfung erfolgreich ablegen. Die anonymisierte Reihung zeigte mir zu meiner großen Überraschung aber auch, dass ich unter den 110 zukünftigen Studenten meiner Sparte an die 28. Stelle gereiht worden war. Ich schien also doch nicht ganz so unfähig zu sein, wie ich dies aufgrund meiner erfolglosen Bewerbungen inzwischen hatte annehmen müssen.
Читать дальше