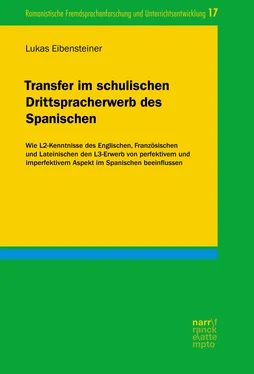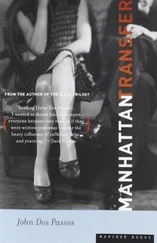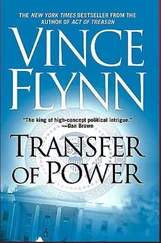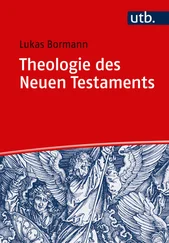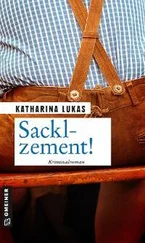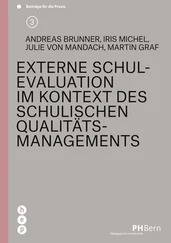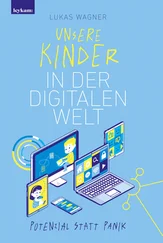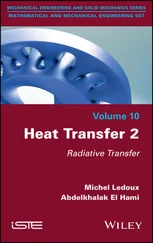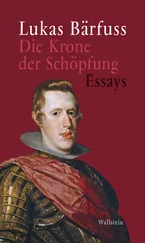Für die Fremdsprachendidaktik bedeuten diese Ergebnisse einerseits, dass das gesamte sprachliche Repertoire der Lernenden ausgeschöpft werden sollte und dass sprachliches Vorwissen vor allem dann zu positivem Transfer führt, wenn sprachstrukturelle Ähnlichkeiten zwischen zwei Sprachen vorhanden sind. Diese in der Theorie durchaus schon lange vorhandenen Annahmen werden durch die empirische Evidenz der vorliegenden Studie untermauert.
Die Arbeit gliedert sich neben der Einleitung in sieben weitere Kapitel, von denen die ersten vier theoretischer Natur sind. Die letzten drei befassen sich mit dem Untersuchungsdesign, den Ergebnissen und der Interpretation derselben. In Kapitel 2 werden einige Grundbegriffe der Tempus- und Aspektforschung eingeführt und mithilfe von Beispielen veranschaulicht. Dies betrifft vor allem die Abgrenzung von lexikalischem/grammatikalischem Aspekt und Tempus. Im Anschluss werden die Vergangenheitssysteme der in der vorliegenden Arbeit behandelten Einzelsprachen näher erläutert. Es wird zuerst auf die beiden germanischen Sprachen, Deutsch und Englisch, eingegangen, bevor im Anschluss daran das Lateinische beschrieben wird. Im letzten Teil des Kapitels werden die romanischen Sprachen, Französisch und Spanisch, dargestellt.
Kapitel 3 beschreibt grundlegende Begrifflichkeiten der Zweit- und Drittspracherwerbsforschung. Es wird auf die Explizit-implizit-Debatte eingegangen und die deklarativ-prozeduralen Modelle von Ullman (2001) und Paradis (2009) werden vorgestellt. Darauffolgend wird in Anlehnung an das Faktorenmodell von Hufeisen (2000) dargelegt, warum sich der Erwerb einer Zweit- von jenem einer Drittsprache unterscheidet.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit Transfereffekten im Zweit- und Drittspracherwerb und geht dabei auf verschiedene Einflussfaktoren, wie beispielsweise die Sprachtypologie, die Psychotypologie oder das Sprachniveau ein. In der Folge werden unterschiedliche Transfermodelle erörtert. Zu diesen zählen sowohl holistische Mehrsprachigkeitsmodelle (vgl. Herdina/Jessner 2002) als auch Transfermodelle aus dem Bereich der kognitiven Linguistik (vgl. Jarvis 2011) sowie der generativistischen Zweit- und Drittspracherwerbsforschung (vgl. Flynn et al. 2004). Des Weiteren werden die L2-Status-Faktor-Modelle beschrieben (vgl. Bardel/Falk 2007).
Studien, die sich mit dem Erwerb von perfektiv/imperfektiv in einer Zweit-/Drittsprache beschäftigen, werden schließlich in Kapitel 5 behandelt. Im ersten Teil werden unterschiedliche Hypothesen besprochen (z. B. Lexical Aspect Hypothesis (vgl. Andersen 1986), Default Past Tense Hypothesis (vgl. Salaberry 2000)) und es wird auf Untersuchungen eingegangen, die empirische Evidenz für die entsprechenden Hypothesen liefern. Der zweite Teil beschäftigt sich mit L1- und L2-Transfer im Bereich des L3-Erwerbs von perfektivem und imperfektivem Aspekt.
Mit Kapitel 6 beginnt der empirische Teil der Arbeit. Es geht zuerst auf die Forschungsfragen und Hypothesen der Hauptstudie ein. Im Anschluss daran wird das Untersuchungsmaterial vorgestellt und kritisch diskutiert, worauf eine Charakterisierung der Probanden folgt. Am Ende steht eine kurze Beschreibung der Vorgehensweise sowie der Datenkodierung und -auswertung.
In Kapitel 7, das sich in einen quantitativen und einen qualitativen Abschnitt untergliedert, werden schließlich die Ergebnisse der Hauptstudie präsentiert. Im quantitativen Teil wird der Einfluss des englischen und französischen Aspektwissens sowie der schulischen Sprachenfolge auf den Erwerb von perfektiv/imperfektiv im Spanischen dargestellt. Im qualitativen Teil werden die Aussagen der Lernenden bezüglich expliziten Regelwissens als auch im Hinblick auf eine sprachvergleichende Herangehensweise analysiert.
Schließlich werden in Kapitel 8 die Ergebnisse zusammengefasst und unter Rückgriff auf die bestehende Forschungsliteratur diskutiert. Am Ende des Kapitels steht eine Auflistung der Limitationen der Studie und es werden Handreichungen für zukünftige Untersuchungen gegeben. Ein Abschnitt zu didaktischen Implikationen sowie ein kurzes Fazit beschließen die vorliegende Arbeit.
Die (Zeit-)Linguistik beschäftigt sich mit der Frage, wie das physikalische Phänomen der Zeit versprachlicht werden kann. Laut Klein (2009b: 40–41) greifen die diversen Einzelsprachen dafür auf sechs Möglichkeiten zurück: Tempus, (grammatikalischer) Aspekt, lexikalischer Aspekt, Temporaladverbien, Temporalpartikeln und Diskursprinzipien. Die nachstehenden Ausführungen fokussieren die ersten drei Möglichkeiten und konzentrieren sich dabei primär auf die temporale Domäne der Vergangenheit und die aspektuelle Unterscheidung von perfektiv/imperfektiv. Das Kapitel gliedert sich in drei Teile: Zuerst werden die Unterschiede zwischen lexikalischem und grammatikalischem Aspekt diskutiert. Im Anschluss wird ein System zur Tempusanalyse vorgestellt (vgl. Klein 1994), das schließlich dazu verwendet wird, die Vergangenheitsformen des Deutschen, Englischen, Lateinischen, Französischen und Spanischen zu beschreiben und voneinander abzugrenzen.
2.1 Tempus und Aspekt aus einer typologischen Perspektive
2.1.1 Lexikalischer Aspekt
Beim lexikalischen Aspekt (en. lexical aspect ) handelt es sich um die inhärente Semantik des Verbs und dessen Argumente.1 In Anlehnung an Vendler (1957) spricht man von vier sogenannten Zeitschemata (en. time schemata ) oder Aspektklassen, die mithilfe folgender Taxonomie zusammengefasst werden können:
| Aspektklassen |
dynamisch |
telisch |
durativ |
Beispiel |
| Zustände (en. states ) |
- |
- |
+ |
sein |
| Aktivitäten (en. activities ) |
+ |
- |
+ |
(Lieder) singen |
| Accomplishments 2 |
+ |
+ |
+ |
ein Lied singen |
| Achievements |
+ |
+ |
- |
den Gipfel erreichen |
Tab. 1:
Klassifikation lexikalischer Aspektklassen (in Anlehnung an Vendler 1957)
Diese Taxonomie beruht im Wesentlichen auf drei aspektuellen Unterschieden: (1) Zustandswechsel (statisch vs. dynamisch), (2) inhärente(s) Ende/Limit/Grenze (telisch vs. atelisch) und (3) zeitliche Ausdehnung (punktuell vs. durativ) (vgl. Filip 2012). Diese drei aspektuellen Unterschiede werden im Folgenden voneinander abgegrenzt:
(1) Der wesentliche Unterschied zwischen statischen und dynamischen Prädikaten liegt darin, dass die Semantik eines Zustands keinen Zustandswechsel nach sich zieht, jene einer Aktivität hingegen schon (vgl. ebd.: 728). Laut Comrie (1976: 48–51) müssen dynamische Prädikate einer ständigen Zufuhr von Energie unterliegen, um fortgesetzt zu werden. Wenn beispielsweise eine Person keine Energie aufwendet, um die Aktivität des Singens aufrechtzuerhalten, wird die Handlung abrupt ein Ende nehmen. Zustände hingegen benötigen Energie, um in den Zustand gebracht zu werden. Haben sie diesen aber erreicht, verweilen sie darin und benötigen keine Energie für die Aufrechterhaltung desselben (z. B. das Buch, das ins Regal gestellt wird, bleibt dort stehen – es ist/verweilt in dem Regal):
With a state, unless something happens to change that state, then the state will continue […]. With a dynamic situation, […] the situation will only continue if it is continually subject to a new input of energy (ebd.: 49).
(2) Der wesentliche Unterschied zwischen telischen und atelischen Prädikaten liegt darin, dass die Semantik von telischen Prädikaten einen inhärenten Endpunkt besitzt. Sie beschreiben also Aktionen, die sich in Richtung eines Endpunktes bewegen und erst dann wahr sind, wenn dieser erreicht wurde. Atelische Situationen hingegen sind schon in dem Moment wahr, in dem sie beginnen (vgl. Garey 1957: 106). Diesen Unterschied veranschaulicht Comrie (1976: 44–48) anhand der Sätze John singt und John singt ein Lied . Obwohl beide Prädikate eine gewisse Dauer ausdrücken und dynamisch sind, gibt es einen wichtigen Unterschied hinsichtlich der Telizität. Egal zu welchem Zeitpunkt John mit dem Singen aufhört, ist die Aussage, dass er gesungen hat, wahr, was auf die Atelizität des Prädikats zurückzuführen ist. Beim zweiten Satz hingegen ist dies nicht der Fall. Wenn John das Singen eines Liedes in der Mitte abbricht und beispielsweise noch die letzte Strophe fehlt, ist die Aussage, dass John ein Lied gesungen hat, nicht wahr, sondern nur dann, wenn John das Lied (inkl. der letzten Strophe) tatsächlich fertig gesungen hat. Dies ist auf den inhärenten Endpunkt von telischen Prädikaten wie bei ein Lied singen zurückzuführen. Wie dieses Beispiel zeigt, interagiert die Semantik der Verben mit den Argumenten derselben. Das atelischen Verb singen in John singt erhält erst durch das Hinzufügen des Akkusativobjektes ein Lied einen inhärenten Endpunkt (= das Ende des Liedes) und wird somit zu einem telischen Prädikat (vgl. auch Comrie 1976: 45).
Читать дальше