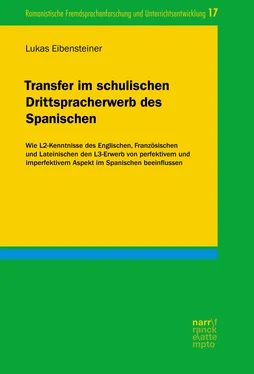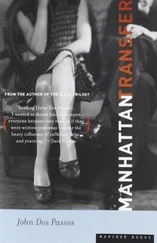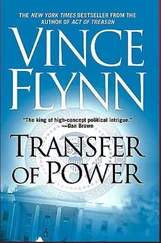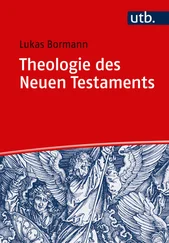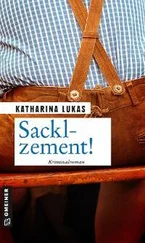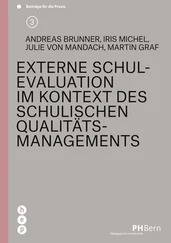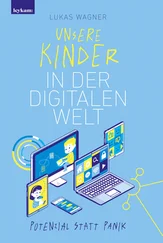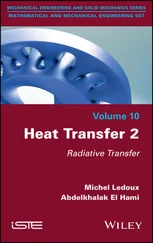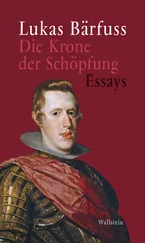Für das Lernen einer sprachlichen Struktur spielen neben der Frequenz auch deren Salienz und Redundanz eine wesentliche Rolle. Beispielsweise werden saliente Konstruktionen schneller gelernt als nicht saliente. Häufig sind auch Erwerbsschwierigkeiten auf eine niedrige Salienz zurückzuführen (vgl. Ellis/Wulff 2015: 420). Dies ist dann der Fall, wenn beispielsweise ein grammatisches Phänomen mit einer anderen salienteren Form in Konflikt tritt und darauffolgend vom Lernenden als redundant wahrgenommen wird. Eine solche Kombination von niedriger Salienz und Redundanz kann sogar dazu führen, dass eine Konstruktion überhaupt nicht erworben wird (vgl. ebd.). Ein Beispiel für diesen Vorgang sind Erwerbsschwierigkeiten bezüglich der Flexionsmorphologie, die vor allem dann auftreten, wenn die Morpheme von sehr salienten Adverbien begleitet werden. Im Hinblick auf den Erwerb von Tempus und Aspekt könnte eine Fokussierung von temporalen Adverbien beispielsweise dazu führen, dass Lernende die entsprechende Morphologie nicht ausreichend beachten und sie dementsprechend langsamer oder im Extremfall gar nicht erwerben.
Prinzipiell sind diese allgemeinen Lernprozesse sowohl für den Erwerb einer L1 als auch für den einer L2 ähnlich. Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings darin, dass im L2-Erwerb das Sprachsystem der L1 schon vorhanden ist. Dieses wird während des Erwerbs der L1 auf die Bedürfnisse und die Systematizität der entsprechenden Sprache eingestellt. Beispielsweise fokussieren L1-Sprecher einer Aspektsprache eher die unterschiedlichen Phasen einer Handlung im Verlauf, wohingegen Sprecher einer Nicht-Aspektsprache primär die Endpunkte derselben betrachten (vgl. Bylund/Athanasopoulos 2015: 4; siehe Kapitel 5.2.1). Diese Aufmerksamkeitsprozesse werden im L1-Erwerb gelernt, weshalb Ellis (2015: 12) auch von gelernter Aufmerksamkeit spricht. Die Aufgabe des L2-Lerners ist es nun, die Aufmerksamkeitsstrukturen der L1 an das L2-System anzupassen (vgl. auch Slobins 1996 thinking-for-speaking -Hypothese in Kapitel 4.3.4):
Learning a language, then, means learning these various attention-directing mechanisms, which requires L1 learners to develop an attentional system in the first place, and L2 learners to reconfigure the attentional biases of having acquired their first language (Ellis/Wulff 2015: 422).
Explizites/bewusstes Wissen kann förderlich sein, Unterschiede zwischen dem L1- und dem L2-System ins Bewusstsein zu rufen, was beim Neu-Lernen der genannten Aufmerksamkeitsprozesse helfen kann. Laut Ellis (2005: 324) ist dies gerade für den Erwerb von nicht salienten und nicht prototypischen Konstruktionen hilfreich. Schmidt (2001: 23) geht sogar davon aus, dass eine derartige bewusste Wahrnehmung eine notwendige Voraussetzung für den erfolgreichen Erwerb einer L2 ist. In der Forschungsliteratur ist dies allerdings durchaus umstritten.
Schmidt (1990: 131–133) unterscheidet diesbezüglich drei Grade von Bewusstheit (en. awareness ): Wahrnehmen (en. perception ), Bemerken (en. noticing ) und Verstehen (en. understanding ; vgl. auch Schmidt 2001: 5). Die Wahrnehmung eines Reizes kann durchaus unbewusst stattfinden, wohingegen das Bemerken mit einem gewissen Grad an Bewusstheit verbunden ist, auch wenn dies nicht zwangsläufig mit der Fähigkeit einhergeht, das Bemerkte zu verbalisieren (vgl. Schmidt 1990: 131–133). Diese Unterscheidung ist von großer Bedeutung, da im Laufe der vorliegenden Arbeit immer wieder von Wahrnehmung gesprochen wird. Es sei deshalb noch einmal betont, dass Wahrnehmung sowohl unbewusst als auch bewusst stattfinden kann. Der dritte von Schmidt genannte Bewusstheitsgrad bezieht sich auf das Verstehen im Sinne eines metasprachlichen Bewusstseins. Dieser Prozess baut auf jenem des Bemerkens auf und ist die Grundvoraussetzung für die Analyse, den Vergleich und die Reflexion über Sprache, was schlussendlich zu dem expliziten Verständnis einer abstrakten Regel und damit zu einem ausgeprägten metasprachlichen Bewusstsein führt. Laut Schmidt (2010: 721–726) kann der Prozess des Verstehens das Lernen eines sprachlichen Phänomens zwar erleichtern, ist aber im Unterschied zum Vorgang des Bemerkens nicht unbedingt erforderlich.
Sollte das Bemerken tatsächlich eine notwendige Voraussetzung für Lernen sein, würde dies bedeuten, dass es kein rein implizites Lernen gibt und immer ein minimaler Grad an Bewusstheit vorausgesetzt werden muss (vgl. Ellis 2009: 7; Paciorek/Williams 2015 für eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung). Ob die bloße Wahrnehmung eines Reizes ausreicht oder ob ein bewusstes Bemerken notwendig ist, kann zum heutigen Stand der Forschung noch nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Im nächsten Kapitel wird ein Überblick gegeben, inwiefern explizites/bewusstes Wissen tatsächlich für den erfolgreichen Erwerb einer L2 (oder einer L3) notwendig ist.
3.2 Die Rolle von explizitem und implizitem Wissen
Vor ungefähr vierzig Jahren hat Stephen Krashen (z. B. 1982: 10–11) die Unterscheidung zwischen explizitem Lernen und implizitem Erwerben in die Zweitspracherwerbsforschung eingeführt.1 Die damit einhergehende Frage, inwiefern explizites und implizites Wissen miteinander interagieren, und ob ersteres für den vollständigen Erwerb einer Sprache notwendig ist, hat seither zu zahlreichen Debatten geführt. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick gegeben.
Im Allgemeinen wird implizites Lernen als unbewusster Prozess beschrieben, für dessen Aktivierung kein Rückgriff auf zentrale Aufmerksamkeitsprozesse notwendig ist. Es handelt sich um einen automatisierten Prozess, der natürlich stattfindet und normalerweise nicht verbalisiert werden kann. Explizites Lernen hingegen bezieht sich auf das Lernen von Faktenwissen und beansprucht das Arbeitsgedächtnis in hohem Maße. Es findet bewusst und kontrolliert statt und kann daher im Regelfall verbalisiert werden (vgl. Ellis 2009: 3; Leow 2015: 47–48; Hulstijn 2005: 131–132; VanPatten/Rothman 2015: 100–101).
Des Weiteren wird in der Literatur zwischen implizitem und explizitem Wissen unterschieden. Diese beiden Wissenskomponenten stellen gewissermaßen die Resultate der entsprechenden Lernprozesse dar (vgl. Ellis 2009: 6). Ellis (2009: 10–16) unterscheidet sie folgendermaßen: Implizites Wissen ist unbewusst, weshalb eine explizite Verbalisierung – ähnlich wie beim entsprechenden Lernprozess – oft schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist. Es kann daher nicht durch Forschungsmethoden, die eine Verbalisierung des Gelernten voraussetzen, sichtbar gemacht werden, sondern ist nur im tatsächlichen Sprachverhalten der Lernenden beobachtbar. Es ist prozedural, wird dementsprechend vorwiegend im prozeduralen Gedächtnissystem gespeichert und kann relativ einfach durch Rückgriff auf automatisierte Verarbeitungsstrategien aktiviert werden. Das prozedurale Gedächtnissystem und damit einhergehend implizites Wissen scheinen einer sensitiven Periode zu unterliegen. Es ist daher wahrscheinlich, dass implizites sprachliches Wissen ab einem bestimmten Alter nicht mehr vollständig erworben werden kann (eine ausführliche Darstellung findet sich in Kapitel 3.3).
Im Gegensatz zu impliziten Wissensrepräsentationen ist explizites Wissen bewusst. Damit geht einher, dass der Lernende beispielsweise die einer sprachlichen Konstruktion zugrunde liegende Regel kennt und im Normalfall in der Lage ist, sie zu verbalisieren. Es besteht aus Faktenwissen über die entsprechende Sprache, ist im deklarativen Gedächtnissystem gespeichert und unterscheidet sich prinzipiell nicht von Faktenwissen anderer Art. Der Zugriff auf explizites Wissen erfolgt intentional und wird durch kontrollierte Aufmerksamkeitsprozesse gesteuert. Es ist bis ins hohe Alter vollständig lernbar und unterliegt keiner kritischen bzw. sensiblen Phase (vgl. Ellis 2009: 10–16).
Читать дальше