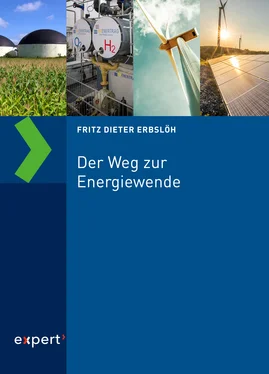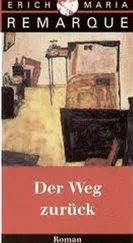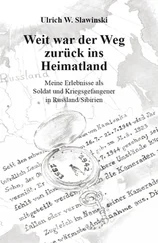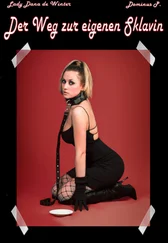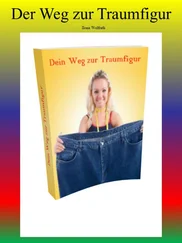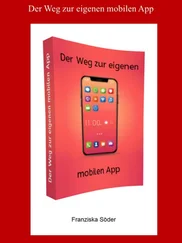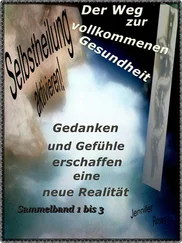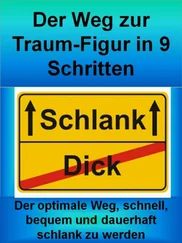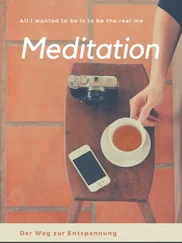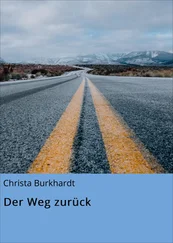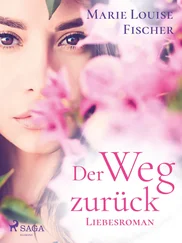„Wir brauchen nicht Wachstum, sondern Entwicklung. Sofern für die Entwicklung ein materieller Zuwachs erforderlich ist, sollte dieser gerecht erfolgen und unter Berücksichtigung sämtlicher realen Kosten finanzierbar und nachhaltig sein.“
„Wir müssen Techniken fördern, die den ökologischen Fußabdruck der Menschheit verkleinern, die Effizienz erhöhen, Ressourcen stützen, Signale deutlicher machen und materielle Benachteiligung beenden.“
„Wir müssen unsere Probleme als Menschen angehen und außer der Technik noch weitere Möglichkeiten zu ihrer Lösung einsetzen.“7
4 Wahrnehmung und Beginn einer Klimapolitik
4.1 Klimakonferenzen
Die Fragen, was der Mensch mit der Welt und speziell seiner Umwelt anstellt und anstellen darf, lagen mit „Grenzen des Wachstums“ auf dem Tisch. Dass zu den dort behandelten Problemen das Thema „Klima“ hinzutrat, ist den Fachwissenschaften und speziell der Meteorologie zu verdanken.
Eine Schlüsselrolle spielte hierbei die Weltorganisation für Meteorologie (World Meteorological Organization – WMO), die am 23. März 1950 gegründet wurde. Sie hatte mit der seit 1873 bestehenden Internationalen Meteorologischen Organisation (IMO) eine Vorläuferin, die als freiwilliger Zusammenschluss der Direktoren staatlicher meteorologischer Dienste und Observatorien bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs arbeitete. Die internationale Zusammenarbeit blickte in diesem Feld also bereits auf eine lange Geschichte zurück – kaum eine andere Wissenschaft ist so auf großräumige Zusammenarbeit angewiesen wie gerade die Meteorologie. Das Wetter macht nicht an politischen Landesgrenzen halt, und alle Staaten sind auf die Wetterbeobachtungen der anderen angewiesen.
Mitglieder der WMO sind nicht Wetterdienste oder deren Direktoren, wie es bei der Vorgängerorganisation IMO der Fall war, sondern Staaten und Hoheitsgebiete, die einen ständigen Vertreter benennen. Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist die Existenz eines eigenen meteorologischen Dienstes. Am 1. Juli 1984 gehörten der WMO 152 Staaten und 5 sog. Territorien an; heute sind es 187 Staaten und sechs Territorien (Stand 2019). Zu diesen Territorien gehört beispielsweise Hongkong, das einen eigenen Wetterdienst besitzt. Deutschland ist mit der Bundesrepublik seit dem 10. Juli 1954 Mitglied der WMO. Sie ist der Organisation als 60. Staat beigetreten. Für sie ist der Präsident des Deutschen Wetterdienstes der Ständige Vertreter bei der WMO.1 Neben dem Welt-Wetterwachtprogramm (WWW Programm) hat das Welt-Klimaprogramm (World Climate Programme ‒ WCP) seit Beginn der 1980er Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen – als Folge der ersten Weltklimakonferenz, die die WMO vom 12.–23. Februar 1979 in Genf veranstaltete. Die Konferenzergebnisse hatten noch im Mai des gleichen Jahres zur Annahme des WCP geführt.
Auf der Konferenz von Genf (kurz WCC 1 genannt) standen der Hintergrund der Klima-Anomalien seit 1972 und die Möglichkeit der Klimabeeinflussung durch die menschliche Gesellschaft im Mittelpunkt. Das Ergebnis war zusammengefasst:
„Die fortdauernde Ausrichtung der Menschheit auf fossile Brennstoffe als wichtigster Energiequelle wird wahrscheinlich zusammen mit der fortgesetzten Waldvernichtung in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten zu einem massiven Anstieg der atmosphärischen Kohlendioxid-Konzentration führen (…) Unser gegenwärtiges Verständnis klimatischer Vorgänge lässt es durchaus als möglich erscheinen, dass diese Kohlendioxid-Zunahme bedeutende, eventuell auch gravierende langfristige Veränderungen des globalen Klimas verursacht; und (…) da das anthropogene Kohlendioxid in der Atmosphäre nur sehr langsam durch natürliche Prozesse abgebaut wird, werden die klimatischen Folgen erhöhter Kohlendioxid-Konzentrationen wohl lange anhalten“ (KAS).2
Die Weltklimakonferenz WCC 1 der WMO folgten noch zwei weitere, sämtlich in Genf als Sitz der WMO, sodass sich die Folge ergibt:
WCC 1, 1979
WCC 2, 1990
WCC 3, 2009
War das Klima bis zur WCC 1 und zur WCC 2 weitgehend eine Angelegenheit der Wissenschaftler und Fachexperten, so änderte sich das mit den Konferenzergebnissen und der steigenden Zahl z. T gleichsinniger, z. T. widerstreitender Veröffentlichungen: 1983 gründeten die Vereinten Nationen die Internationale Kommission für Umwelt und Entwicklung (WCED = World Commission on Environment and Development) als unabhängige Sachverständigenkommission. Diese Kommission veröffentlichte vier Jahre später ihren Bericht zur Zukunft, der nach ihrer Vorsitzenden auch als BRUNDTLAND-REPORT bekannt wurde. In ihm wurde ein Leitbild zur sogenannten Nachhaltigen Entwicklung zum Programm erhoben, das bis heute gültig ist.
Der Brundtland-Bericht stellte im einzelnen fest, dass kritische, globale Umweltprobleme i.A. das Resultat großer Armut im Süden und von nicht nachhaltigen Konsumgewohnheiten und Produktionsmustern im Norden sind (Nord-Süd-Gefälle). Er verlangte somit eine Strategie, die Entwicklung und Umwelt zusammenbringt und formulierte den Leitsatz:
„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.”3
Aus „dauerhafter Enwicklung” wurde schnell „nachhaltige Entwicklung”, ein Begriff, der ursprünglich wohl auf die Forstwirtschaft zurückgeht, für die der sächsische Oberberghauptmann H. C.VON CARLOWITZ schon 1713 eine „nachhaltende Nutzung“ verlangt hatte, s. Kap. 2, Die Anfänge: Ressourcen. Sein Begriff wurde ins Englische mit „sustainable“ übertragen.Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.
Vor dem Hintergrund des Brundtland-Berichtes beriefen die Vereinten Nationen nach langen Vorbereitungen 1992 eine zweite große Umweltkonferenz ein, die in Rio de Janeiro mit großer Beteiligung von Experten und Regierungen stattfand.
Wesentliches Ergebnis war die sogenannte Agenda 21, die detaillierte Handlungsaufträge für den sozialen, ökologischen und ökonomischen Sektor formulierte.
Bisher gab es drei weitere Folgekonferenzen solcher „Weltgipfel”. Nach 5 Jahren fand am 23.–27. Juni 1997 in New York der Weltgipfel Rio +5 statt. Hauptthema war: Welche Veränderungen haben die Hauptakteure – Regierungen, internationale Politiker, Wirtschaft, Gewerkschaften, Frauengruppen und andere – in den fünf Jahren nach Rio erreicht? Am Gipfel nahmen 53 Staats- und Regierungschefs sowie 65 Minister für Umwelt oder anderer Ressorts teil.
Der Weltgipfel Rio +5 hatte folgende Ziele:
Wiederbelebung und Stärkung der (Selbst-)Verpflichtungen für eine nachhaltige Entwicklung,
Offenes Feststellen von Versagen und Identifizieren der jeweiligen Gründe,
Erkennen von Erreichtem und Identifizieren von Aktionen, die in der Sache weiterführen,
Festlegen von Prioritäten für die Zeit nach 1997,
Feststellen der Probleme, die in Rio nicht genügend gewürdigt wurden.
Der Weltgipfel Rio +5 endete im Prinzip mit großer Ernüchterung bis hin zur Enttäuschung und eigentlich mit nur einer Übereinstimmung, nämlich dass es der Erde schlechter gehe als je zuvor. Hierüber konnten kleinere lediglich auf einzelnen Sektoren erreichte Fortschritte, wie z.B. bei Klimaveränderungen, Waldverlusten oder knappen Süßwasserreserven nicht hinwegtäuschen. Probleme zeichneten sich insbesondere ab bei der Zunahme der Emissionen von Treibhausgasen und bei der Freisetzung toxischer Stoffe und fester Abfälle. Insbesondere wegen der Nord-Süd-Differenzen darüber, wie nachhaltige Entwicklung global finanziert werden sollte bzw. könnte, gab es keine großen Durchbrüche. Im Schlussdokument, das sich als sog. Programm für die weitere Umsetzung der Agenda 21 von Rio verstand, wurden weiche, allgemeine Formulierungen gewählt, um die zutage getretenen Differenzen notdürftig zu überdecken.
Читать дальше