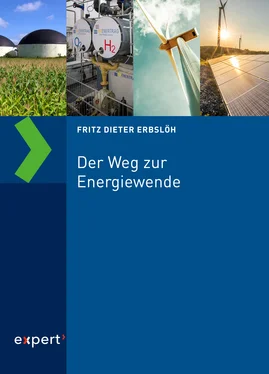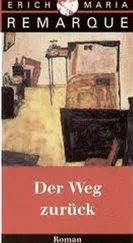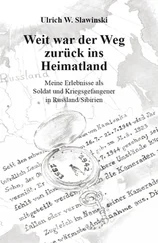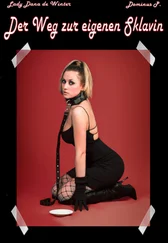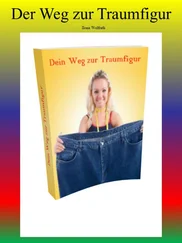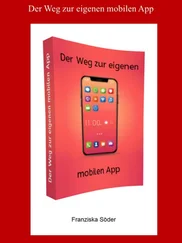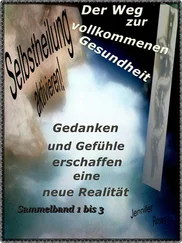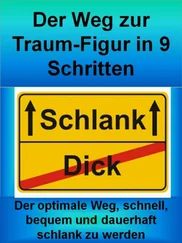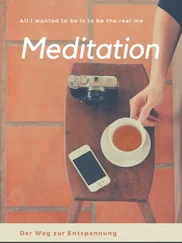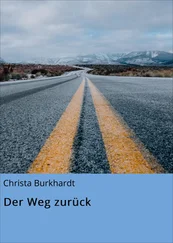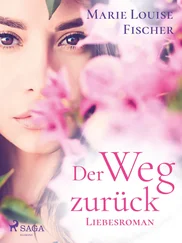Die industrielle Entwicklung hatte die Begrenztheit der agrarwirtschaftlichen bzw. vorindustriellen Ressourcenbasis überwunden, oder man glaubte dies zumindest. In der Ökonomie fand das seine Spiegelung im Bild eines säkularen Wirtschaftswachstums, das aus immer wiederkehrenden, sich selbst regulierenden Umläufen von Güter- und Geldströmen entsteht. Auf der Seite der Technik entsprach diesem ökonomischen „perpetuum mobile“ die Idee eines ständigen Fortschritts, der aufgrund kontinuierlich verbesserter Methoden auch die für das Wachstum erforderliche fossile Energie und die notwendigen Rohstoffe beschaffte.
Es war eine Art von Kreislaufmodell19, das auch von den Naturwissenschaften gestützt schien. Die notwendige Korrektur kam 1824 von S. CARNOT mit dem Verständnis des thermodynamischen Wirkungsgrades und der Folgerung, dass alle realen Vorgänge irreversible Komponenten enthalten und die Rückkehr in den Urzustand immer nur über die Zufuhr von Energie läuft.20
Die beiden sogenannten Hauptsätze der Thermodynamik21 verallgemeinerten um 1850 diese Einsichten, sodass H. VON HELMHOLTZ 1862 von einem konstanten „Kraftvorrat des Weltganzen“ sprechen konnte, der aus zwei Teilen bestünde, nämlich einem ständig kleiner werdenden „Vorrat, der die Änderungen unterhält“, und einen dauernd zunehmenden „Vorrat, der keine Änderungen mehr möglich macht“.22
Bei den Technikern wurde vor allem der „Erhaltungssatz“ rezipiert und als Bestätigung des Kreislaufmodells verstanden. Es war R. CLAUSIUS, der hier deutlicher wurde und verständlicher formulierte, „daß ein Naturgesetz aufgefunden ist, welches mit Sicherheit schließen läßt, daß in der Welt nicht alles Kreislauf ist, sondern daß sie ihren Zustand fort und fort in einem gewissen Sinne ändert und so einem Grenzzustande zustrebt“.23 Und später, in einer gesonderten Veröffentlichung von 1885 ganz konkret hinsichtlich der sorglosen Verwendung der Kohle: „Diese verbrauchen wir nun, und verhalten uns dabei ganz wie lachende Erben, welche eine reiche Hinterlassenschaft verzehren. Es wird aus der Erde heraufgeschafft, so viel sich durch Menschenkraft und technische Hilfsmittel nur irgend heraufschaffen lässt, und das wird verbraucht, als ob es unerschöpflich wäre.“ Er forderte in der gleichen Schrift, den Bedarf künftig so weit wie möglich mit heute so genannten regenerativen Energiequellen zu decken, insbesondere mit elektrisch übertragener Wasserkraft. Während das vergangene Jahrhundert der Menschheit die Naturkräfte dienstbar gemacht habe, „werden die folgenden Jahrhunderte die Aufgabe haben, in dem Verbrauch dessen, was uns an Kraftquellen in der Natur geboten ist, eine weise Ökonomie einzuführen, und besonders dasjenige, was wir als Hinterlassenschaft früherer Zeitepochen im Erdboden vorfinden, und was durch nichts wieder ersetzt werden kann, nicht verschwenderisch zu verschleudern.“24
Auch der langjährige VDI-Direktor F. GRASHOF rügte 1877 den verschwenderischen Kohlenraubbau und forderte einen schonenden Umgang mit den Energieressourcen, vor allem durch „Gleichgewichts- und Kreislauftechniken, die die auf der Welt insgesamt konstante Arbeitsmenge nur immer wieder nutzbringend umschichten“ sollten.25 Das lief auf eine Notwendigkeit des Haushaltens mit den endlichen Naturvorräten hinaus.
Die Mahnungen blieben jedoch ohne Folgen. Die Erschließung immer neuer Rohstoffvorkommen und Kraftquellen im Inland und vor allem in den Kolonien ließ die Vorräte als nahezu unendlich erscheinen, wie Veröffentlichungen von z.B. 1888 zeigen: „Hiernach würde Deutschland bei einer gleichen Gewinnung wie die gegenwärtige von rund 60 Millionen Tonnen für 1 Jahr noch für etwa 6.000 Jahre Kohle besitzen oder den gegenwärtigen Verbrauch Europas auf etwa 1.500 Jahre decken.“26
Dann kam es Ende des 19. Jahrhunderts jedoch mit der „energetischen Bewegung“ des Physikochemikers A. W. OSTWALD zu einem neuen Impuls. Sein übergreifender metaphysischer Ansatz verband Physik, Technik und Staat durch sein Grundprinzip von der Verbesserung des Nutzens: „Der ökonomische Koeffizient der Energietransformation ist so wirklich der allgemeine Maßstab menschlicher Angelegenheiten.“27 1912 formulierte er seinen Energetischen Imperativ: „Vergeude keine Energie, sondern nutze sie!“28
OSTWALDS Verdienst ist es damit, ein normatives Leitbild einer „dauerhaften Wirtschaft“ geschaffen zu haben, letztlich ein Vorläufer der „sustainable economy“. Er hatte damit auch Resonanz, allerdings mehr zufällig aufgrund des „Kohlennot-Alarms“ von 1900, einer hochkonjunkturbedingten massiven Kohlenknappheit.29
Das Denken in Wirkungsgraden verbreitete sich schnell in der Technik und führte vor dem Ersten Weltkrieg zu einer „progressiv-technokratischen Ingenieurbewegung, die sich z. T. auch kritisch gegen die Kaufleute in den Unternehmungsleitungen richtete und latent antikapitalistisch war. Ziel dieser Bewegung war der Kampf gegen jegliche Vergeudung von Energie-, Material- und Arbeitsressourcen in der Gesamtwirtschaft.“30
Der erste Weltkrieg verschärfte unter dem Eindruck der Knappheit die Bemühungen um rationelleren Umgang mit den Ressourcen. Namentlich sind hier W. RATHENAU und W. VON MÖLLENDORF zu nennen, die sich für eine generelle Verbrauchssenkung von Energie und Rohstoffen einsetzten, bei RATHENAU 1917 dazu noch verbunden mit allgemeinen gesellschaftspolitischen Zielsetzungen: „Heute ist jeder Verlust, jede Verschwendung Sache der Gemeinschaft.“31 Ähnliche Reformansätze gab es in den USA, auch hier von den Ingenieuren ausgehend. Sie reichten dort über das Kriegsende hinaus und manifestierten sich in einer „Revolt of Engineers“.
Mit der Rückkehr zu „normalen“ Verhältnissen nach dem Krieg mit gutem Angebot von Energie und Rohstoffen in den 1920er Jahren verflachte in den USA wie in Deutschland die energetische Bewegung zu einer Rationalisierungsstrategie nach TAYLOR und FORD. Der „Energetische Imperativ“ war etwas für Notzeiten gewesen, den man bei einem reichen Angebot an Rohstoffen und Energieträgern schnell wieder vergaß. Fast typisch wiederholte sich dieser Prozess im und nach dem zweiten Weltkrieg. Erst die Debatte über die Grenzen des Wachstums der 1970er Jahre und vor allem die beiden Ölpreiskrisen 1973–1975 und 1979–1982 beendeten diese Phase des sorglosen Umgangs mit Rohstoffen und Energie.
Die Mahnungen aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hatten zwar keine unmittelbaren praktischen Folgen für den Umgang mit Energie gehabt, wie oben erläutert. Aber sie hatten doch die Reichweitendiskussion angestoßen, die auch nach dem Aufkommen des Erdöls die Szene bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts beherrschte, als sich mit der Kernenergie eine scheinbar unerschöpfliche Energiequelle auftat. Ihre Ergebnisse wurden zwar jeweils zur Kenntnis genommen, gaben jedoch keinen Anlass zum grundlegenden wirtschaftlichen oder technischen Wandel, zumal sich immer Korrektive auftaten. So bewahrheitete sich die Prognose einer schnellen Kohlenkrise nicht – mit dem Beginn der Erdölnutzung ab 1859 gab es für die Kohle Konkurrenz und zumindest partiellen Ersatz.
Die Problematik der Reichweite der Vorräte stellte sich allerdings auch hier. Sie wurde sogar offensichtlicher und führte zu etlichen Kassandra-Rufen: die mühsam erschlossenen Ölfelder erschöpften sich oft binnen weniger Jahre. Das zeigte sich früh in den USA, die den Erdölboom 1859 mit der Bohrung von DRAKE in Pennsylvania angestoßen hatten. DRAKES Bohrung war zwar nicht der erste erfolgreiche Fund – 1844 hatte schon der russische Ingenieur F. N. SEMYENOV mit einem Schlagbohrsystem eine erste Ölquelle im auch heute noch genutzten Ölfeld von Bibi-Eibat erschlossen – jedoch verfügten die Amerikaner über das Patent des kanadischen Arztes und Geologen A. P. GESNER auf die Herstellung von Petroleum aus Kohle oder Erdöl. Das gab dann den Ausschlag für ihre künftig führende Rolle im neu entstehenden Ölmarkt.
Читать дальше