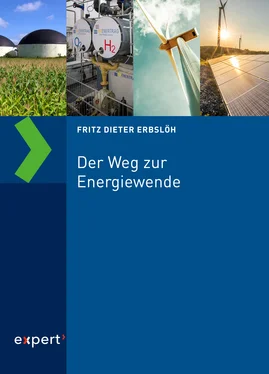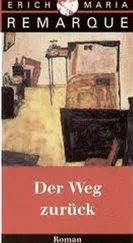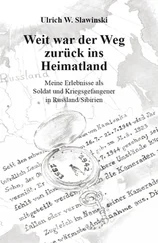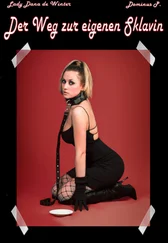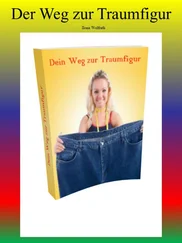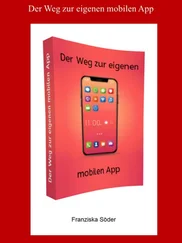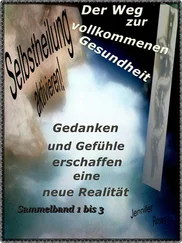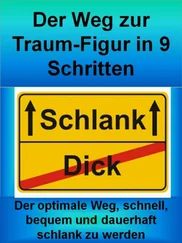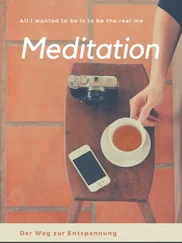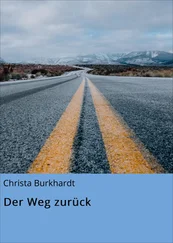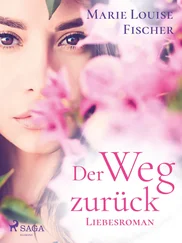1 ...6 7 8 10 11 12 ...23 Der Weltgipfel Rio +10 in Johannesburg, 26. August bis 4. September 2002, hatte erneut die Umsetzung der Rio-Konvention (Agenda 21) zum Gegenstand, wobei dieses Mal die fortgeschrittene Globalisierung neue Akzente setzte.
Zum 20-jährigen Jubiläum fand schließlich die 3. Nachfolgekonferenz (Rio + 20) vom 20. Juni bis 22. Juni 2012 statt, wieder in Rio. Die Konferenz versammelte erneut die Staats- und Regierungschefs, um die 1992 gegebenen Impulse zur Nachhaltigkeit wieder aufzugreifen und zu erneuern.
Allerdings war schon im ersten Treffen des Vorbereitungskomitees sichtbar geworden, dass der Gegensatz zwischen reichen und armen Ländern sich kaum überbrücken ließ. Der Vorwurf, die reichen Länder würden die Nachhaltigkeit ihrer Standards zur Abschottung ihrer Märkte missbrauchen, stand im Raum.
In der rund 50 Seiten starken Abschlusserklärung mit der Überschrift „Die Zukunft, die wir wollen” bekannte sich die Staatengemeinschaft dennoch zum Konzept einer Green Economy, um die natürlichen Ressourcen stärker zu schonen. Außerdem verständigte man sich darauf, bis 2014 universell gültige Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) auszuarbeiten. Auch sollte das bestehende Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP – UN Environment Programme) gestärkt und aufgewertet werden.4
Insgesamt wurden die Ergebnisse des Gipfels eher als Enttäuschung gewertet. Bundeskanzlerin A. MERKEL äußerte sich kritisch, aber auch konstruktiv zum Abschlussdokument:
„Die Ergebnisse von Rio bleiben hinter dem zurück, was in Anbetracht der Ausgangslage notwendig gewesen wäre. Die Europäische Union und Deutschland hatten sich für verbindlichere Aussagen eingesetzt. Aber einmal mehr haben wir gesehen: Wir sind nicht alleine auf der Welt; es ist recht schwierig, bestimmte Dinge durchzusetzen. … Richtig ist aber auch, dass die Ergebnisse zumindest ein weiterer Schritt in die richtige Richtung sind. Ich will dazu drei Punkte nennen.
Erstens: Die sogenannte Green Economy … Umweltschonendes Wirtschaften wurde von den Vereinten Nationen als wichtiges Instrument für eine nachhaltige Entwicklung gewürdigt. Damit erkennt nun die gesamte Staatengemeinschaft an, dass in einem Green-Economy-Konzept, das der jeweiligen Situation eines Landes angepasst ist, große Chancen liegen. Das heißt, Ökonomie und Ökologie werden nicht mehr als Widerspruch, sondern als Einheit wahrgenommen …
Zweitens: In Rio wurde beschlossen, die bisherige Kommission für nachhaltige Entwicklung abzulösen. Künftig wird es ein hochrangiges politisches Forum für nachhaltige Entwicklung geben. Damit kann das Thema Nachhaltigkeit mehr politisches Gewicht auf der Agenda der Vereinten Nationen erhalten. Es ist uns leider nicht gelungen, das UN-Umweltprogramm UNEP in Nairobi zu einer Sonderorganisation aufzuwerten. Aber wir konnten UNEP durch die Einführung einer universellen Mitgliedschaft und eine bessere Finanzausstattung stärken. …
Drittens: In Anlehnung an die bisherigen Millennium-Entwicklungsziele sollen nun auch „Sustainable Development Goals“ erarbeitet werden. Damit erhöht sich der politische Handlungsdruck im Sinne von Nachhaltigkeit. Jetzt müssen wir allerdings die Konferenzergebnisse in der Praxis konkretisieren. Denn allein die Feststellung, dass man so etwas will, reicht natürlich nicht aus. …”
Und schließlich noch a. a. O. das für Europäer nicht überraschende Grundsatzbekenntnis:
„Ein solcher Entwicklungspfad von Gesellschaften begründet sozusagen eine neue Kultur: die Kultur der Nachhaltigkeit. Diese Kultur der Nachhaltigkeit stellt die Lebensgewohnheiten eines jeden von uns auf den Prüfstand. Das gilt für das Berufsleben genauso wie für das Privatleben.”5
Der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), H. WEIGER, kritisierte dagegen die wenig konkreten Zielvorschläge: „Blumige Absichtserklärungen und ein Aufguss früherer Gipfelbeschlüsse hälfen dem globalen Ressourcenschutz nicht.”6
Abgesehen von Rio 1992 stellt sich damit die Bilanz der großen Weltkonferenzen als eher durchwachsen dar. Die Teilnahme der Regierungschefs war dem Fortschritt in der Sache wohl eher hinderlich (was im Nachhinein die angekündigte Abwesenheit der deutschen Bundeskanzlerin in Rio 2012 rechtfertigt). Schwierige Detailfragen lassen sich im kleineren Kreis der Fachleute oft besser behandeln, und Kompromisse sind auf diesem Wege häufig eher möglich.
Neben den Weltgipfeln gibt es ein weiteres, auf die Welt-Klima-Probleme gerichtetes Konferenzformat auf der Arbeitsebene: die UN-Klimakonferenz, die seit 1995 regelmäßig tagt und die Klimakonferenzen der WMO abgelöst hat. Auf diese unter dem Kürzel COP geführten Veranstaltungen wird im Kap. 5.1, Klimakonvention und Kyotoprotokoll, einzugehen sein.
Neben WMO, Weltklimakonferenzen, Weltgipfeln, COP, CMP gibt es noch eine weitere internationale Einrichtung, die sich um das Weltklima und seine Stabilisierung kümmert: den IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) als Gremium der Experten.
Der IPCC wurde 1988 von der UN-Umweltorganisation (UNEP) und der WMO gegründet. Seine Aufgabe ist es, die Politik neutral über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Klimaveränderung und zu möglichen Gegenmaßnahmen zu informieren. 195 Staaten sind Mitglieder des IPCC. Sie benennen jeweils Experten, meist Fachwissenschaftler, die ihre Berichte eigenständig erstellen und als (weitgehend) unabhängig gelten. Das Gremium hat seinen Sitz in Genf und betreibt keine eigene Forschung, sondern wertet eine große Zahl von anerkannten Studien aus und fasst die zentralen Erkenntnisse daraus zusammen. Den breiten wissenschaftlichen Konsens sichern mehrere tausend beim IPCC registrierte Gutachter, die die Berichte kommentieren und natürlich auch kritisieren können (und sollen).
Publizität gewinnt der IPCC regelmäßig durch seine großen Sachstandsberichte, von den bisher nach einem ersten im Jahr 1990 vier weitere im Abstand von 5‒6 Jahren erschienen sind. Der bislang letzte ist der Fünfte Sachstandsbericht (AR5) von 2013/14, der als Ergebnis eines fünfjährigen Arbeitsprozesses in drei Bänden vorgelegt wurde. Die Kernergebnisse des ersten, die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels und künftige Entwicklungen des Klimasystems behandelnden Bandes zeigt die nachstehende Auflistung:1
Die atmosphärische CO2-Konzentration liegt heute rund 40 % über vorindustriellem Niveau.
Die Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche stieg zwischen 1880 und 2012 um 0,85 °C.
Auch die Ozeane haben sich deutlich erwärmt.
Die drei Jahrzehnte seit 1980 waren jeweils wärmer als jedes andere Jahrzehnt seit 1850.
Eindeutig der Mensch ist verantwortlich für den größten Teil der Erwärmung zwischen 1951 und 2010.
Mit wenigen Ausnahmen schrumpfen weltweit die Gletscher, und das Tempo beschleunigt sich.
Die Ausdehnung des arktischen Meereises sinkt seit 1979 um durchschnittlich 3,8 % pro Jahrzehnt.
Etwa 30 % des durch menschliche Aktivität freigesetzten CO2 wurden von den Ozeanen aufgenommen, die deutlich versauern.
Die weltweiten Meeresspiegel werden bis ca. 2100 um etwa 2682cm steigen.
Steigt der Treibhausgas-Ausstoß weiter wie bisher, erwärmt sich die Erde bis ca. 2100 um 2,6 bis 4,8 °C.
Der sechste IPCC-Sachstandsbericht als Hauptprodukt des aktuellen Berichtszyklusses (2016‒2022) wird 2021/22 veröffentlicht. Daneben kennt der IPCC Sonderberichte, von denen sich der jüngste vom Oktober 2018 auf das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels fokussierte.
Die Berichte sind in der Regel etwa 1.500 Seiten stark und durch eine Vielzahl von Mitwirkenden erstellt. Angesichts der Vielzahl zusammengetragener Informationen und der breiten Mitwirkung anerkannter Klimawissenschaftler gelten diese Berichte als der heilige Gral der Klimaforschung – sie geben letztlich den Mainstream vor.
Читать дальше