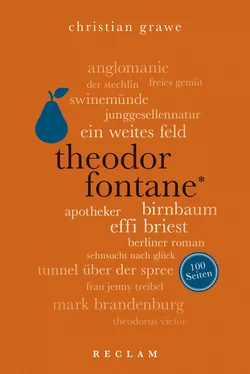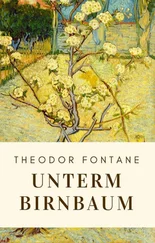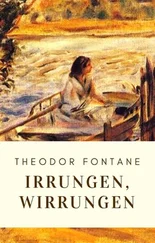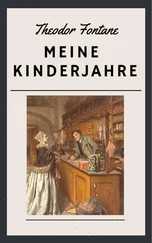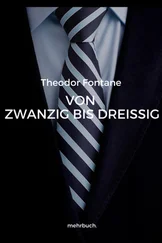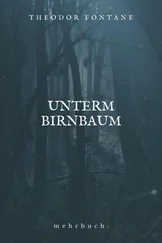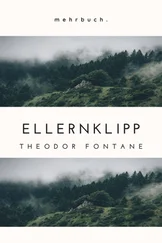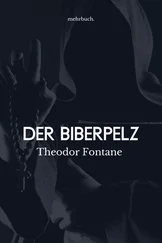»Rezept- und Versemachen«
Gut die nächsten zehn Jahre verbrachte Fontane in seinem erlernten Beruf: als Apotheker. Er arbeitete in diesen Jahren in acht Apotheken an verschiedenen Orten und behauptete später stolz, er habe »nur Stellungen innegehabt, die für die besten in Deutschland galten« ( Von Zwanzig bis Dreißig ). Seine Ausbildung absolvierte er von 1836 bis 1840 in der Roseschen Apotheke in Berlin. Ihr Besitzer erschien ihm zeit seines Lebens als die Inkarnation des Bourgeois: »in einem fort quasseln sie vom ›Schönen, Guten, Wahren‹ und knixen doch nur vor dem goldenen Kalb« ( Von Zwanzig bis Dreißig ). Noch als alter Mann bestätigte Fontane seiner Tochter: »Ich hasse das Bourgeoishafte mit einer Leidenschaft, als ob ich ein eingeschworner Socialdemokrat wäre.« In dem Roman Frau Jenny Treibel hat er diesen Typ in der Titel-›Heldin‹ ironisch und humorvoll porträtiert.
Nach der Abschlussprüfung arbeitete Fontane drei Jahre lang als Apothekergehilfe. Die abschließende Prüfung 1847 machte ihn zum »approbierten Apotheker erster Klasse« und berechtigte ihn, »zur Verwaltung und zum Besitze einer Apotheke in den Königlichen Landen«, aber zweimal scheiterte der Kauf einer Apotheke nach seinem eigenen Eingeständnis an seiner »Vermögenslosigkeit«. Die Lebensbedingungen der Apothekenangestellten waren damals miserabel. Dem Freund Wilhelm Wolfsohn beschrieb er seine Unterbringung in Berlin:
Ich bewohne eine Schandkneipe, einen Hundestall, eine Räuberhöhle mit noch zwei andern deutschen Jünglingen und habe keine freie Verfügung über diese Schlafstelle, die viel vor Erfindung dessen, was man Geschmack, Eleganz und Comfort heißt, vermuthlich von einem Vandalen erbaut wurde.
En passant sollen zwei Ereignisse während dieser Jahre nicht übergangen werden: Erstens absolvierte Fontane 1844/45 als Einjährig-Freiwilliger seine Wehrpflicht. Und zweitens wurde er zweimal »unglückseliger Vater eines illegitimen Sprößlings«, wie er Bernhard von Level bekannte. Genaueres darüber wissen wir leider nicht.
Während all dieser Jahre als kümmerlich bezahlter Apotheker verfolgte Fontane seine Karriere als Schriftsteller. Bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr verfasste er eine Fülle von literarischen Texten: Hunderte von Gedichten, einen Roman, Erzählungen, ein Epos, ein Dramenfragment, ein kleines satirisches Trauerspiel, Zeitungskorrespondenzen, Theaterkritiken und eine Übersetzung von Shakespeares Hamlet. Bald bemühte er sich auch darum, seine Dichtungen in Zeitschriften unterzubringen. Aber der Erfolg, der es ihm erlaubt hätte, von seiner literarischen Arbeit zu leben, blieb aus. Im Dezember 1839 erschien seine erste Erzählung (»Geschwisterliebe«, sentimentaler Kitsch), im Januar 1840 sein erstes Gedicht . In der zweiten Jahreshälfte 1849 stand die Veröffentlichung seiner ersten drei selbständigen Gedichtbände bevor ( Von der schönen Rosamunde. Romanzenzyklus und Männer und Helden. Acht Preußenlieder , 1850, und Gedichte , 1851), und so fasste Fontane Ende September den Entschluss, »den ganzen Kram an den Nagel zu hängen«, und sein »literarisches Leben auf den ›Vers‹ zu stellen« ( Von Zwanzig bis Dreißig ). Aber der Versuch scheiterte schon nach einem halben Jahr, »denn ein Apotheker, der anstatt von einer Apotheke von der Dichtkunst leben will, ist so ziemlich das Tollste, was es gibt«. Aus Geldmangel war Fontane daher gezwungen, eine subalterne Stelle im konservativen preußischen Innenministerium anzunehmen. Im Alter von dreißig Jahren erlebte Fontane nun, in den Jahren 1849/50, entscheidende Veränderungen, und zwar beruflich und privat und auch in seinen politischen Einstellungen.
»Vom rothen Republikaner zum Reactionair«
Die aufgeheizte politische Stimmung der Vierzigerjahre, die 1848 in der Revolution kulminierte, erfasste Fontane 1842 in Leipzig, wo er dem linksradikalen Herwegh-Club beitrat. Seine »ganze Lyrik« war nun »auf Freiheit gestimmt« ( Von Zwanzig bis Dreißig ). An der Berliner Märzrevolution 1848 beteiligte er sich begeistert: Er nahm »mit einem Karabiner in der Hand«, wie er Jahrzehnte später an Georg Friedlaender schrieb, an den Barrikadenkämpfen teil. Als die preußische Regierung die Revolution blutig niederschlug, veröffentlichte Fontane über dreißig radikale Korrespondenzen und beklagte, dass in Preußen »an die Stelle eines militärisch organisierten Rechtsstaates das Schreckgespenst polizeilicher Willkür« getreten sei. Aber noch im selben Jahr »verkaufte« Fontane sich nach seinem eigenen Eingeständnis an Bernhard von Lepel »der Reaction für monatlich 30 Silberlinge« und wurde gewissermaßen im Handumdrehen zum Konservativen .
Zwanzig Jahre lang exponierte sich der so genannte ›mittlere Fontane‹ nun publizistisch als so extremer Konservativer, dass von Lepel ihn vor »Reaction und Katholizismus« warnte (so Fontane in seinem Tagebuch) und sogar seine Frau, zu Besuch bei ihrer Freundin in Schlesien, ihm zu bedenken gab: »namentlich stimme ich so oft mehr mit [von Lepels] liberalen Gesinnungen als mit Deinen Conservativen, mir ist oft, als sähest Du die Dinge verschleiert an. Hier ist alles Fortschritt.«
Von 1851 bis 1860 arbeitete Fontane in verschiedenen subalternen Positionen für die konservative preußische Regierung. Trotz der gelegentlichen Versuche, diese konservativen Jahrzehnte als Konzession ans ›Brotverdienen‹ oder gar verheimlichte Fortschrittlichkeit herunterzuspielen, besteht kein Zweifel, dass Fontane als »aufrichtiger Constitutioneller« hier seine politische Heimat sah: Briefe aus diesen Jahren an verschiedene Adressaten bestätigen die Echtheit seiner konservativen Überzeugungen. Paul Heyse erklärte er, »man wird mit den Jahren ehrlich und aufrichtig konservativer«, Bernhard von Lepel, »ich darf aufrichtig sagen, daß ich Preußen und die Hohenzollern so aufrichtig und so immer wachsend liebe«, und Wilhelm Hertz, »auch ist das ächte, ideale Kreuzzeitungsthum eine Sache, die bei Freund und Feind respektirt werden muß, denn sie ist gleichbedeutend mit allem Guten, Hohen und Wahren«. Seine früheren Überzeugungen verunglimpfte er 1854 als »Schwindel«, und die Liberalen 1861 als »den reinen Treibsand, der durch die Strömung, wie sie gerade geht, mal hierhin mal dorthin geworfen wird«. Die progressive politische Lyrik der Vierzigerjahre, zu der er doch selbst beigetragen hatte, erschien ihm spät im Leben als »Freiheitsphrasendichtung« ( Von Zwanzig bis Dreißig ) .
Es passt nicht zu dieser gegensätzlichen parteilichen Zugehörigkeit innerhalb weniger Jahre, dass Fontane als gut Sechzigjähriger erklärte: »Ich bin absolut einsam durchs Leben gegangen, ohne Klüngel, Partei, Clique, Coterie, Club, Weinkneipe, Kegelbahn, Skat und Freimaurerschaft, ohne rechts und ohne links, ohne Sitzungen und Vereine.« In Wirklichkeit war er ein ausgesprochener ›Vereinsmeier‹. Nicht nur politisch, sondern auch literarisch suchte er über Jahrzehnte Halt und Freundschaft in Vereinigungen. Seine späte Selbstcharakterisierung als »ein Singleton, ein Einsiedler von Jugend auf« ist eine der nicht wenigen Mystifikationen und Stilisierungen des Alters. Fontane trat seinem ersten Verein 1840 bei und war dann im Laufe seines Lebens Mitglied in sechs literarischen Vereinen. Sie prägten seine literarische Entwicklung und machten einen erheblichen Teil seines freundschaftlichen Umgangs aus. In zwei von ihnen blieb er Jahrzehnte lang aktiv. Besonders der Berliner ›Tunnel über der Spree‹ war für ihn ab 1843 literarisch und psychologisch wichtig: »Dort machte man einen kleinen Gott aus mir«, wie er sich 1893 erinnerte. Im ›Tunnel‹ trug Fontane bis 1865 über hundert Gedichte vor und wurde vor allem für seine Balladen gefeiert.
Читать дальше