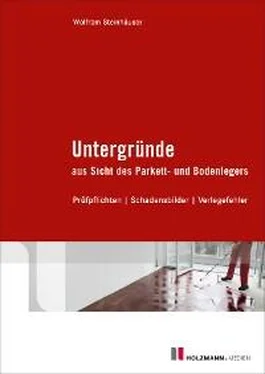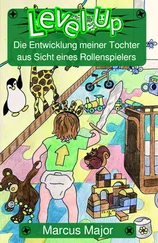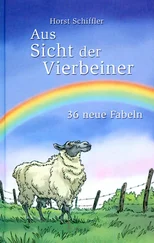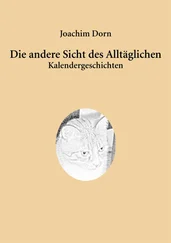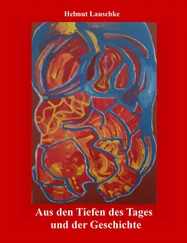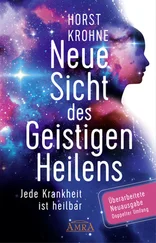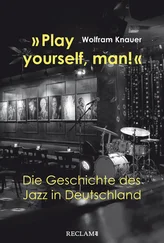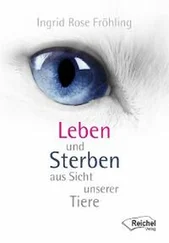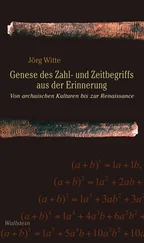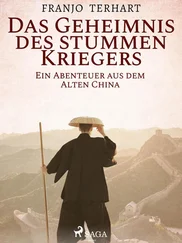Der Untergrund darf nicht feuchtigkeitsempfindlich sein, wie beispielsweise Steinholzestrich und Calciumsulfatestrich,
der Untergrund muss sich im frostfreien Bereich befinden, und
die Reaktionsharzgrundierungen müssen für die Absperrung von Untergrundfeuchte geeignet sein.
Die Verlegewerkstoffhersteller machen dazu die erforderlichen Angaben. Zu Betonuntergründen wird im Kommentar zur DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Stand 2010, Folgendes ausgeführt:
„Bei Betondecken ohne und mit Verbundestrich ist eine aussagefähige Messung des Feuchtegehaltes mit gewerbeüblichen Messgeräten nicht möglich. Die in der oberen Zone des Untergrundes gemessenen Werte lassen keinen Rückschluss auf die Feuchte der Betondecke im restlichen Querschnitt zu. Da bei Betondecken ohne und mit Verbundestrich Trocknungszeiten von einem Jahr und mehr erforderlich werden, sind durch die verbleibende Feuchte in solchen Untergründen Mängel oder Schäden an darauf verlegten Bodenbelägen aller Art nicht auszuschließen. Der Auftraggeber hat deshalb durch geeignete planerische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Feuchte aus dem Untergrund die Verlegewerkstoffe (Grundierungen, Spachtelmassen, Klebstoffe) und den Bodenbelag nicht beeinträchtigt. Da die Entscheidung über die Art der Ausführung ausschließlich beim Auftraggeber liegt und der Auftragnehmer darauf keinen Einfluss hat, kann dem Auftragnehmer die Verantwortung für Schäden am Bodenbelag durch nachstoßende Feuchtigkeit aus der Rohdecke oder dem Estrich nicht aufgebürdet werden. Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden und daraus resultierenden Mängeln an den Bodenbelägen, Sockelleisten, Spachtelmassen u. ä. durch Feuchte aus dem Untergrund sind zwischen den beteiligten Parteien abzustimmen. Die Prüfung der Restfeuchte der Deckenkonstruktion (u. a. der Rohbetondecke) ist keine Prüfpflicht der Bodenbelagsarbeiten.“
Bei den verschiedenen Betonuntergründen hat sich deshalb folgende Vorgehensweise durchgesetzt: Die Untergründe werden kugelgestrahlt, mit einem Industriesauger abgesaugt und anschließend mit einer geeigneten, vom Verlegewerkstoffhersteller empfohlenen Reaktionsharzgrundierung grundiert. In der Regel wird anschließend gespachtelt und der Belag verlegt. Wenn die Betonuntergründe ausreichend planeben sind, kann durchaus mit geeigneten Klebstoffen auf die Reaktionsharzgrundierungen Parkett geklebt werden.
Grundsätzlich muss man zwischen der Untergrundfeuchte unmittelbar vor der Ausführung der Parkett- und Bodenlegerarbeiten und der Dauertrockenheit eines Untergrundes unterscheiden. Für die Prüfung der Untergrundfeuchte ist der Parkett- und Bodenleger verantwortlich. Für die Dauertrockenheit eines Untergrundes ist der Bauherr bzw. sein Planer, Architekt, Bauleiter und im Neubau der Estrichleger verantwortlich. Dazu zwei Beispiele aus der Baupraxis:
Planung und Einbau von Trennlagen auf neu eingebaute Betonuntergründe
Auf die Planung und den Einbau von Trennlagen zur Feuchteabsperrung unmittelbar auf neu eingebaute Betonuntergründe (Stahlbetondecken, Betonbodenplatten) wird häufig verzichtet. Dabei sollte eigentlich jeder Planer und Estrichleger wissen, dass bedingt durch die hohe Restfeuchte der Betonuntergründe ein Dampfdruckgefälle vom Betonuntergrund weg und hin zu den angrenzenden Räumen vorliegt. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, wenn sich beispielsweise unterhalb der neuen Stahlbetondecke Heizleitungen oder andere Wärmeerzeuger befinden. Wer als Planer oder Estrichleger auf den Einbau von zwei Lagen PE-Folie der Dicke 0,2 mm oder einer einlagigen PVC-Folie der Dicke 0,5 mm unmittelbar auf den neuen Betonuntergrund verzichtet, nimmt wissentlich Feuchteschäden an der gesamten Fußbodenkonstruktion und den Oberbelägen in Kauf. Hier hat es zahlreiche Schäden gegeben, deren Beseitigung sehr kostenintensiv war. Trotzdem ist der Einbau dieser Folien nach wie vor strittig. In der Regel verzichten die Estrichleger auf den Einbau dieser Folien. Strittig zwischen Planer, Bauleiter und Estrichleger ist auch die Prüfpflicht des Estrichlegers im Hinblick auf die Überprüfung der Notwendigkeit von Dampfsperren und Abdichtungen, um die Dauertrockenheit des Estrichs zu gewährleisten.
Erdberührte Fußbodenkonstruktionen
Mit ca. 12 % aller an Bauwerken festgestellten Mängeln erweisen sich Bauwerksabdichtungen als besonders schadensträchtig. Vor allem Feuchteschäden an erdberührten Bauteilen schlagen in der Regel mit großen Schadenssummen zu Buche und verursachen die mannigfaltigsten Schadensbilder. Für die Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen stehen einige Normen, technische Regelwerke, Richtlinien und Merkblätter zur Verfügung. Grundsätzlich basiert die Ausführung von Bauwerksabdichtungen auf der DIN 18195 Teil 1 bis 10. Diese Norm beschreibt die Grundsätze von Bauwerksabdichtungen. Sie enthält Begriffsbestimmungen und gilt beispielsweise für die Abdichtung von nicht wasserdichten Bauwerken und Bauteilen gegen
Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser sowie
von außen drückendes Wasser.
Die Wahl der einzusetzenden Abdichtungsart ist im Wesentlichen von der Angriffsart des Wassers, von der Nutzung des Bauwerks, der Bodenart, der Geländeform und des Bemessungswasserstandes am jeweiligen Gebäudestandort abhängig. Hier sollte eigentlich jeder Parkett- und Bodenleger aufhorchen. Die Festlegung der Abdichtungsart bei erdberührten Fußbodenkonstruktionen sollte ein Planer/Architekt treffen, der die genannten Bedingungen unbedingt beachten muss. In einem Neubau ist das auch die Regel, sodass hier die Parkett- und Bodenleger im Hinblick auf Dauertrockenheit nichts befürchten müssen. In der Sanierung und Renovierung sieht das ganz anders aus, da hier meistens kein Planer eingeschaltet wird und die Parkett- und Bodenleger die Planung übernehmen. Bei alten erdberührten Fußbodenkonstruktionen sind die Abdichtungen gegen Feuchte aus dem angrenzenden Erdreich in aller Regel defekt oder nicht vorhanden. Um hier eine Dauertrockenheit für die Ausführung der Parkett- und Bodenbelagsarbeiten zu erzielen, wird gewöhnlich wie folgt vorgegangen:
Voraussetzung für die Absperrung eines feuchtigkeitsunempfindlichen und frostfreien Untergrundes mit einer geeigneten dampfbremsenden Sperrgrundierung ist der Lastfall – Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser. Für den Lastfall – drückendes und aufstauendes Wasser – sind zwingend geeignete Abdichtungen nach DIN 18195 Teil 6 in die Fußbodenkonstruktion einzubauen. Der Planer muss also im Vorfeld die Boden- und Grundwasserverhältnisse abklären, beispielsweise über die örtlichen Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.
Der Sd-Wert der einzusetzenden Sperrgrundierung muss höher sein als die Summe der Sd-Werte aus den Verlegewerkstoffen und dem Oberbelag. Das bedeutet, Oberbeläge mit einem hohen Sd-Wert erfordern auch Absperrungen mit einem hohen Sd-Wert. Epoxidharzgrundierungen haben beispielsweise in der Regel einen Sd-Wert von ca. 65. Wird auf die Epoxidharzgrundierung 2 mm dick gespachtelt und ein 2 mm dicker PVC-Belag geklebt, beträgt die Summe aus den Sd-Werten Spachtelung plus Kleber plus PVC-Belag gleich 42. Somit wird beim Lastfall Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser kein Feuchteschaden am PVC-Belag und den Verlegewerkstoffen entstehen. Die „Dampfbremse“ Sperrgrundierung sorgt dafür, dass der Wasserdampf nicht schneller und intensiver auf die Verlegewerkstoffe, das Parkett und die Bodenbeläge einströmt, als er durch die Verlegewerkstoffe, das Parkett und die Bodenbeläge hindurch diffundieren kann. Unter dieser Prämisse werden Feuchteschäden an der Fußbodenkonstruktion vermieden. Bei der Sd-Wert-Planung muss unbedingt der Verlegewerkstoffhersteller einbezogen werden. Er muss vorgeben, wie groß der Sd-Wert seiner Absperrgrundierungen ist. Außerdem werden im BEB-Merkblatt „Hinweise zum Einsatz alternativer Abdichtungen unter Estrichen“ Planungsbeispiele eingehend erläutert.
Читать дальше