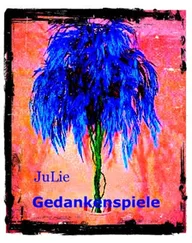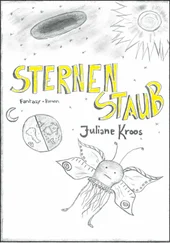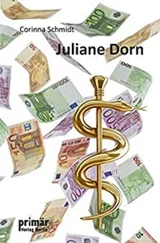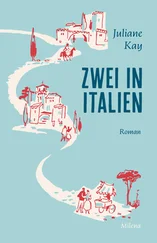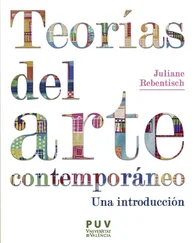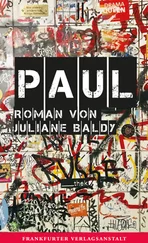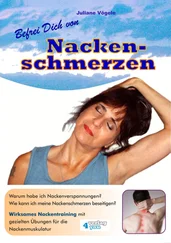Wer sind also „die Medien“? Die Antwort ist einfach und kompliziert zugleich. „Die Medien“ sind niemand. Dahinter stecken Menschen, Journalisten, Redakteure, Autoren, Moderatoren, Reporter und viele mehr. Es gibt unzählige Berufsgruppen, die für „die Medien“ arbeiten. Im besten Fall kann man behaupten „die Medien“ sind der Sammelbegriff für alle diese publizistisch arbeitenden Menschen. Dazu gehören auch Verleger, Drucker, Fotografen, Kameraleute, Techniker aller Art und viele mehr. Und sie alle denken, arbeiten und empfinden so unterschiedlich, wie es nun mal in der Natur eines jeden Einzelnen liegt.
Wer also mit „den Medien“ Kontakt hat, trifft folglich in erster Linie auf einen individuellen Menschen, dessen Arbeit von eigenen Meinungen und persönlicher Erfahrung geprägt ist. Sich dieser Tatsache bewusst zu werden, hilft dabei, ohne falsche Erwartungen und ohne Vorurteile in Kontakt mit „den Medien“ zu treten.
Wenn Unternehmer, Politiker, Verbandsvorsitzende, Akademiker, Experten unterschiedlichster Fachgebiete, aber auch normale durchschnittliche Menschen Kontakt mit „den Medien“ bekommen, ist ihr Ansprechpartner zumeist ein ausgebildeter Journalist oder eine Journalistin. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den folgenden Kapiteln das generische Maskulinum verwendet. Kolleginnen aller Medienbereiche mögen sich von dieser Formulierung achtungsvoll eingeschlossen fühlen.
3. KAPITEL
„Die Medien“ – Freund oder Feind?
Keines von beidem!
Die Aufgabe von Journalisten ist es zu berichten. Und das möglichst informativ und neutral. Kritisches Nachfragen ist ihnen eine selbstverständliche Pflicht. Ebenso wie einen Sachverhalt aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Wie sonst wäre eine weitgehend objektive und ausgewogene Darstellung denkbar?
In Demokratien sollen die Medien das Volk informieren und durch Kritik und Diskussion zur allgemeinen Meinungsbildung beitragen. Häufig wird deshalb auch von der 4. Macht oder der 4. Gewalt im Staat gesprochen. Im Pressekodex verpflichten sich Journalisten, alle gesellschaftlichen Prozesse mit wachsamen Augen kritisch zu beobachten. Als Mediennutzer, also als Zeitungsleser oder Fernsehzuschauer, finden wir gerade diese Betrachtungsweise angemessen.
Wenn wir allerdings mit demselben kritischen Blick gesehen werden und sich dieser in der Berichterstattung widerspiegelt, reagieren wir möglicherweise empört und fühlen uns falsch beschrieben. Dabei empfinden wir uns genau genommen „als Opfer“ der gleichen journalistischen Arbeitsweise, die wir in anderen Fällen ausdrücklich erwarten. Ein prominentes „Opfer“ ist beispielsweise der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Stets hatte er sich erfolgreich medienwirksam inszeniert, bis er sich nach der Entdeckung des erschummelten Doktortitels aus dem Amt geschrieben fühlte.
Bei jedem Medienkontakt ist es hilfreich, diesen Mechanismus zu bedenken. Nur weil Sie einen guten Draht zu einem Journalisten haben, dürfen Sie nicht erwarten, dass er ausschließlich in Ihrem Sinne berichtet. Denn damit hätte er seinen Arbeitsauftrag nicht professionell erledigt.
Journalisten sind eben auch Dealer.
Journalisten sind eben auch Dealer. Sie geben ihren Kunden das, wonach diese suchen. Und das sind nicht ausschließlich objektive Informationen. Gewünscht sind genauso Einblicke in die Abgründe der menschlichen Seele, Berichte von dramatischen Lebensumständen und Sensationen jeglicher Art. Gewünscht sind dabei auch negative oder traurige Meldungen. Wer jeden Abend in den Nachrichten von einem sicher gelandeten Flugzeug hört, würde sehr bald nicht mehr einschalten. Dem Absturz mit Verletzten und Toten wird dagegen erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Wir Menschen haben offenbar ein tiefsitzendes Interesse an Leid. Ob aus Mitgefühl oder Sensationslust – wer will das beurteilen. Dennoch wird oft auf die Medien geschimpft. Ständig wühlten Journalisten im Dreck und beförderten Negatives ans Licht, so der gängige Vorwurf. Dabei wird gern übersehen, dass es nicht die Journalisten sind, die existierende Missstände zu verantworten haben.
In den Planungsredaktionen wählen die Verantwortlichen Themen aus, bewerten sie und ordnen sie in den Nachrichtentag ein. Manchmal werden hier auch Themen „gemacht“. Lange bevor die Medien beispielsweise über Mobbing berichtet haben, gab es zwar mit Sicherheit schon Probleme am Arbeitsplatz. Aber der Faktor einer psychischen Erkrankung durch Mobbing gelangte erst durch die Berichterstattung ins öffentliche Bewusstsein.
Doch aus welcher Quelle auch immer eine Geschichte kommt, bevor sie publiziert wird, klopfen die Journalisten sie auf verschiedene Gesichtspunkte hin ab und prüfen die Fakten. Der Berichtsgegenstand sollte möglichst wie folgt sein:
– aktuell,
– von allgemeinem Interesse,
– nachvollziehbar,
– Missstände aufzeigend,
– auf Verbesserungen hinweisend,
– menschlich,
– lehrreich,
– unterhaltsam.
Stärken stärken, Schwächen schwächen.
Dies sind die wichtigsten Faktoren, die dazu führen, die Aufmerksamkeit der Medien für ein Thema oder eine Person zu wecken. Ist dies gelungen, garantiert ein erster Schritt in die Öffentlichkeit natürlich nicht automatisch, dass der Auftritt oder das Interview von der breiten Masse auch positiv aufgenommen wird. Es gilt etliche Stolperfallen zu umgehen. Schon individuelle Besonderheiten einer Person können ein Grund dafür sein, dass diese einen negativen Eindruck hinterlässt. Viele Menschen sind bei ersten Medienkontakten verunsichert. Der Eine stottert, der Nächste tritt extra forsch auf. Und die meisten stellen in dieser ungewohnten Situation plötzlich fest, dass sie ganz anders reagieren als im Alltag.
Der erste Eindruck ist prägend. Das gilt nicht nur für die Wirkung bei den Mediennutzern, sondern gleichermaßen auch für das Verhältnis zum Journalisten. Deshalb ist es so wichtig, gleich beim ersten Kontakt möglichst viel von dem zu zeigen, was man zu bieten hat. Erkenntnisse aus Psychologie und Verhaltensforschung helfen bei der Selbsteinschätzung und beim Umgang mit solchen Erstunsicherheiten.
Das Motto dazu im Medientraining lautet:
Stärken stärken und Schwächen schwächen.
Es gibt Menschen, die wünschen sich mediale Aufmerksamkeit. Andere haben Angst davor. Zwei klassische Beispiele zu jeder der beiden Varianten folgen auf den nächsten Seiten:
Ich will in „die Medien“
A: Unternehmer XY hat ein neues, wirklich ungewöhnliches Produkt. Leider verkauft es sich nicht gut. XY wünscht sich, dass die Medien über das Produkt berichten. Deshalb wendet er sich eigeninitiativ an die Presse.
Vorsicht: Journalisten lassen sich nicht gern als Marketinginstrument missbrauchen! Im schlimmsten Fall wird nach einer Recherche (wenn es denn überhaupt dazu kommt) nicht über das neue Produkt berichtet, sondern über die mangelhafte Ausstattung der Sozialräume der Mitarbeiter.
B: Ein Verein sammelt Spenden für sozial schwache Kinder im Nachbarstadtteil. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter wünschen sich dafür mediale Aufmerksamkeit, weil die Not der Betroffenen wirklich groß ist und mehr Menschen davon wissen sollten, um ebenfalls zu helfen.
Vorsicht: Ja, die engagierten Menschen haben recht. Doch jeder dritte Deutsche ist ehrenamtlich tätig. Die Medien wählen sehr genau nach Relevanz aus. Das dauerhafte Anklopfen an die Redaktionstüren kostet viel Arbeit und kann frustrierend enden. Die Energie wäre möglicherweise in der eigentlichen Nachbarschaftshilfe besser eingesetzt. Wer glaubt, dass die eigene Arbeit zwingend auf mediale Aufmerksamkeit angewiesen ist und diese aktiv sucht, sollte sich dafür einen Profi leisten. Eine PR-Abteilung, einen Kommunikationsexperten, eine Agentur. Für kleinere Unternehmen oder Betriebe gilt: Medienkommunikation ist Chefsache. Ohne den Segen von Oben sollte nicht jeder Mitarbeiter selbst formulierte Informationen an die Presse leiten.
Читать дальше