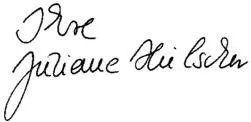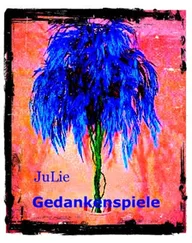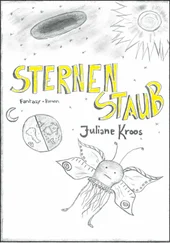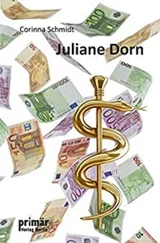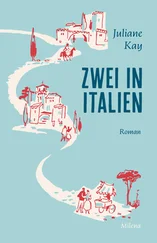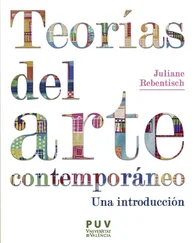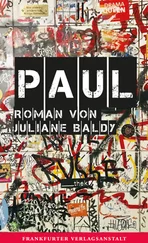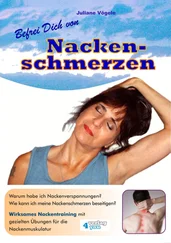Das Gespräch mit Pressevertretern folgt jedoch eigenen Regeln. Sie wissen vorab nicht genau, was man von Ihnen will. Ob man Ihnen gegenüber skeptisch oder wohlgesonnen eingestellt ist. Und Sie haben relativ wenig Einfluss darauf, in welchem Zusammenhang Sie zitiert werden. Ein Mikrofon unter der Nase, Zeitdruck, provokante Fragen und die Hightech-Atmosphäre eines Fernsehstudios haben schon manch gestandenen Manager ins Stammeln gebracht. Nervosität entsteht immer dann, wenn wir uns auf unbekanntem Terrain unsicher fühlen. Eine wirkungsvolle Maßnahme dagegen ist eine gute Vorbereitung! Wer genau weiß, was er wie sagen will, und sich mit der Arbeitsweise der Presse vertraut gemacht hat, kann dem nächsten Interview selbstbewusst und entspannt entgegensehen.
Dieses Buch können Sie chronologisch von A – Z lesen. Wenn Sie aber an bestimmten Fragen interessiert sind, finden Sie in jedem Kapitel abgeschlossene Informationseinheiten. Auf vertiefende Inhalte zu anderen Fragen wird jeweils gesondert hingewiesen.
Die folgenden Kapitel bieten Ihnen eine Fülle von Erläuterungen und Informationen. Ein echtes Live-Training, ein persönliches Medientraining ersetzen sie jedoch nicht. Theoretisches Wissen und praktische Anleitungen sind zwar die Grundvoraussetzungen, doch messbarer Erfolg kann nur durch eigenes Trainieren garantiert werden. Wie in jeder Kunst fallen auch die Medienmeister nur selten vom Himmel. Medientraining lässt sich anschaulich mit Tanzunterricht vergleichen. Wir alle wissen, wie beeindruckend es aussieht, wenn ein Paar leichtfüßig und elegant über das Parkett gleitet. Vielleicht beherrschen Sie sogar noch aus der Tanzstunde einige Schrittfolgen von Walzer und Bossa Nova. Für einen beneidenswert schwebenden Auftritt auf dem nächsten Bundespresseball reicht das aber vermutlich nicht aus.
Manches von dem, was Sie in diesem Buch finden, mag Ihnen wie Binsenweisheiten vorkommen. Umso besser. Dadurch wird es Ihnen leichter fallen, die theoretischen Tipps in die Praxis umzusetzen. In erster Linie geht es darum, Ihr Bewusstsein zu schärfen, für die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten, die Ausdruckswerkzeuge und die unterschiedliche Wirkung die Sie damit erzielen können. Es gibt nicht den einen richtigen Königsweg zum perfekten Auftritt in der Öffentlichkeit. Der Eindruck, den Ihre Medienpräsenz hinterlässt, ist abhängig davon, wie Sie agieren und was Sie auf welche Weise sagen. Wenn wir via Journalisten mit der Welt kommunizieren, wissen wir nicht, wer der Leser, Zuschauer oder Hörer ist. Die Situation dieser Rezipienten ist unbekannt. Von ihren Sorgen, Nöten, Erfahrungen, Gefühlen und Einstellungen werden wir meist nichts erfahren. Nur die Wenigsten schreiben Leserbriefe oder nutzen die Kommentarfunktion, die viele Internetseiten inzwischen anbieten. Meist erhalten wir kein individuelles Feedback. Und selbst wenn, können wir den Eindruck, den wir erweckt haben, im Nachhinein schwerlich ändern.
Deshalb lautet der elementarste Rat, den ich geben kann:
Seien Sie sich stets darüber bewusst, was Sie und wie Sie etwas mit einem Medienvertreter besprechen.
Nur so können Sie die unangenehme Überraschung vermeiden, dass sich die Wahrnehmung der Öffentlichkeit gänzlich von dem Bild unterscheidet, das Sie selbst von sich haben. Unbefangenes Plaudern birgt etliche Gefahren. Mit ein wenig Übung und einem sorgsamen Umgang mit Pressevertretern lassen sich die Risiken allerdings erheblich mindern.
Denn wir alle sind ja gerne auch mal ein wenig einfältig. Unsere Gehirne folgen evolutionär vorgeprägten Mustern. Der Hang zu Vorurteilen gehört dazu. Jemand der groß und attraktiv ist, suggeriert uns leicht, dass er auch kompetent ist. Eine volle und tiefe Stimme verspricht uns eine selbstsichere, vertrauenswürdige Person. Zeit zum Überprüfen dieser Eindrücke nehmen wir uns selten. Der Umstand, dass wir alle zu solchen Einschätzungen neigen, birgt viele Nachteile, aber natürlich auch einen Vorteil. Wenn wir einen guten Eindruck machen, gut rüberkommen, dann gewinnen wir an Glaubwürdigkeit. Ausdrücklich möchte ich betonen, dass es nicht um Manipulation geht! Niemand lässt sich gern etwas vormachen und beim Thema Authentizität reagieren die meisten Menschen sehr sensibel. Deshalb gilt bei allem, was Sie aus diesem Buch für Ihren Medienauftritt lernen: Bleiben Sie immer Sie selbst. Und geizen Sie nicht mit Ihren guten und starken Seiten. Denn Sie wissen ja, was der Volksmund sagt:
Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.
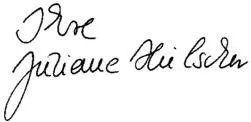
1. KAPITEL
Berichten „die Medien“ die Wahrheit über die Wirklichkeit?
Nicht ja, nicht nein, nicht jein!
Für jeden, der verstehen möchte, wie er in der medialen Öffentlichkeit wirkt und wie man selbst die Wirkung maßgeblich beeinflussen kann, sind einige Auskünfte zu dem Stichwort „Neuronale Informationsverarbeitung“ hilfreich. Denn alles was wir durch die Presse erfahren, schnappen wir mit unseren fünf Sinnen auf, gerade so wie im richtigen Leben.
Seit vielen Jahrhunderten schon quälen sich Philosophen aller Herren Länder mit dieser nicht fassbaren Wirklichkeit. Bislang ist ihr niemand auf die Schliche gekommen. Jüngst hat die fortschrittliche Neurobiologie der Wirklichkeit kurzerhand den Garaus beschert. Anhänger des sogenannten Konstruktivismus hatten sich bereits vor Jahrzehnten von der Realität verabschiedet. Ade Wirklichkeit, dich gibt es nicht, hat es nie gegeben und wird es nie geben. Die sich rasant entwickelnden digitalen Medien mit all ihren virtuellen Welten, Gleichzeitigkeiten und viralen Verknüpfungen sind mit Sicherheit kein probates Mittel, um ein letztes Zipfelchen von Wirklichkeit zu retten. Doch dank der Neurobiologie wissen wir vorerst, wie der Hase läuft. Sie bietet Erkenntnisse, die uns eine neue Sicht der Dinge ermöglicht. Natürlich nur so lange, bis uns andere Wissenschaftler plausiblere Erklärungen anbieten. Bis dahin geht das mit der Wirklichkeit so: Jeder Mensch hat seine eigene. Es existiert nichts objektiv Vergleichbares. Wir nehmen die Welt mit unseren Sinnesorganen wahr. Augen, Nase, Ohren, Mund und der Tastsinn stehen dafür zur Verfügung. Schon gibt es so genannte Cyberanzüge, die Körpergefühle simulieren. Auch mit Geruchs- und Bewegungskino wird seit der Jahrtausendwende experimentiert. Vor allem in Asien ist das Interesse an zusätzlichen Sinneseindrücken bei der medialen Informationsvermittlung groß.
Doch keine der Methoden ist marktfähig. Deshalb gelten die Geruchsmedien größtenteils als unrealistische Spielerei. Trotzdem hat der Medienkonsument auch haptische Eindrücke. Sie können beispielsweise die Druckerschwärze Ihrer Zeitung riechen und auch das Papier in den Händen fühlen. Sie könnten sie sogar essen. Doch selbst wenn sie Ihnen schmecken sollte, erlangen Sie weniger Erkenntnisse über die Welt, als wenn Sie das Gedruckte darin lesen. Zur Vorbereitung des Medientrainings konzentrieren wir uns deshalb auf das Sehen und das Hören.
Das Auge selber sieht keine Bilder. Das Ohr hört keine Töne. Beide sind, wie alle anderen Sinnesorgane auch, nur dafür entwickelt, dass sie Signale aufnehmen können. Im Fall der Medienkommunikation visuelle und akustische Signale. Diese werden in eine Art Code übersetzt und durch neuronale Verbindungen an das Gehirn geschickt. Das ist schon der ganze Job der Sinnesorgane. Die neuronalen Codes sind übrigens neutral und sogar bei allen Sinnesorganen gleich. Das Gehirn arbeitet wie eine Art elektrochemischer Apparat, der die Welt selbst nicht wahrnehmen kann. Aber es kann diese Codes wie eine Sprache verstehen, sie identifizieren, interpretieren und einem Sinnesorgan zuordnen. Aus Millionen von Informationen zimmert es sich dann eine Vorstellung der Wirklichkeit zusammen. Wir glauben dann, dass die Welt tatsächlich objektiv so ist. Aber das ist wohl ein Trugschluss. Denn das wichtigste Hilfsmittel beim Zuordnen und Verstehen der Codes ist unser Gedächtnis. Erst das Gedächtnis stiftet den Sinn, nachdem jedes Signal mit vorherigen Informationen verglichen und verknüpft worden ist. So nehmen wir alle die Wirklichkeit ganz unterschiedlich wahr. Denn in jedem Kopf sind individuelle Kombinationen von Vorerfahrungen abgespeichert. Geschlecht, Alter, Herkunft, Bildung, Gesundheitszustand, körperliche Eigenarten, familiäre Traditionen und alle Erlebnisse eines Menschen beeinflussen jeweils, wie ein Wahrnehmungssignal vom Gehirn verstanden und interpretiert wird. Und davon hängt es ab, welche Gedanken und Gefühle unser Kopf daraus bastelt.
Читать дальше