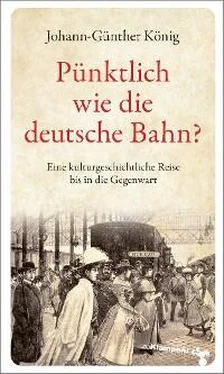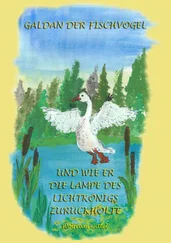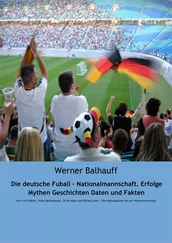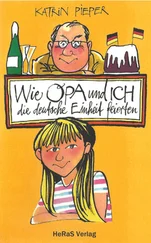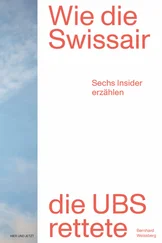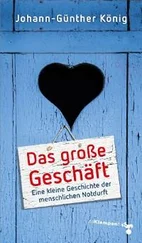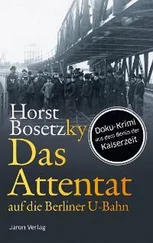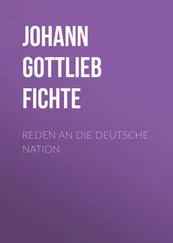Zu Beginn des Schienenpersonenverkehrs rekrutierten sich die Fahrgäste fast ausschließlich aus den höheren Ständen, aus Adeligen, Staatsbeamten, Künstlern und wohlhabenden Bürgern, die bis dahin mit eigenen oder Miet- oder Postkutschen unterwegs gewesen waren. Und was machten einige dieser Herrschaften? Sie ließen sich schon in den 1840er Jahren – also längst vor dem 1930 erfolgten Start der Autoreisezüge – in ihrer eigenen Kalesche auf einem sogenannten Equipage-Wagen mitnehmen, um bei der Ankunft am Zielbahnhof sofort (mit Mietpferden) weiterzuckeln zu können. Das kostete natürlich extra – bei der Königlich Bayerischen Eisenbahn exakt 45 Kreuzer für die Equipage und 20 Kreuzer pro Pferd (der Tageslohn eines Arbeiters betrug 36–54 Kreuzer). Weniger Begüterte konnten in den postkutschenähnlichen Wagenkästen mit Lederschürzen vor den Fenstern eine schmale Sitzgelegenheit ergattern, während gar nicht Begüterte in offenen und ungefederten Wagen im Stehen oder mit Glück auf harten Holzbänken durchgerüttelt wurden. Ihnen pfiff dabei der Fahrtwind um die Ohren, und ein plötzlicher Regenschauer durchnässte die Kleidung, wobei der Rauch der Lokomotive mit längerer Fahrtdauer auch noch ihre Gesichter schwärzte. Was Wunder, dass an den Stationen Händler sogenannte Eisenbahnbrillen feilboten …
Gab es die vielbeschworene »gute alte Zeit« für Bahnreisende? Da in den gängigen Publikationen zumeist Erinnerungen und literarische Fundstücke präsentiert werden, die die Eisenbahn-Nostalgie befeuern helfen, ziehe ich vor allem Texte heran, die erhellen, dass die Eisenbahngesellschaften und ihr Personal seit jeher von anspruchsvollen Fahrgästen mit Argusaugen überwacht und kritisiert werden. 43Die erste mir bekannte Kritik ereilte hierzulande die Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft knapp zwei Monate nach der Betriebsaufnahme der Linie Nürnberg–Fürth im Februar 1836. Sie erfolgte in der nach wie vor empfehlenswerten Form einer Höflichen Bitte :
Wir bitten Sie, verehrte Herren
Inhaber vom Dampfwagen!
Leih’n Sie uns Ihre Ohren gern,
Um etwas vorzutragen:
Der Tritt zum Wagen ist zu hoch,
Um auf und ab zu gehen;
Da kann sich leicht im Sprunge doch
Manch’ schöner Fuß verdrehen.
Drum lassen – o wir bitten Sie,
Steigeisen Sie anschmieden;
Dies lässt sich ja mit leichter Müh’
Durch Aktien vergüten.
Da es die Pflicht des Christen ist,
Fehltritte zu vermeiden,
So hofft man, wird in kurzer Frist
Der Wunsch erfüllt, mit Freuden. 44
Natürlich waren und sind Beanstandungen von Bahnreisenden nicht immer, in manchen Fällen gar nicht berechtigt – in der Regel aber schon. Im September 1839 stand im Tagblatt für Politik, Literatur, Kunst und Wissenschaft zum Beispiel zu lesen: »München, 7. Sept. Seit einigen Tagen, namentlich gestern, bei allerdings sehr ungünstiger Luftströmung, hörte man häufig von Fahrgästen auf der Eisenbahn Klagen über Beschädigungen von Kleidungsstücken durch das unvermeidliche Aussprühen der Funken aus dem Kamine der Locomotive. Das Directorium, diese Klagen berücksichtigend, verspricht in einer heute erschienenen Bekanntmachung, die Bahnfahrten der nächsten Woche betreffend, Alles anzuwenden, daß durch mechanische Vorrichtungen, auch mittelst sorgfältiger Aufsicht auf die Wahl und Behandlung des Brennmaterials, derlei Beschädigungen verhütet würden. Viele glauben, daß dem Uebelstande alsogleich abgeholfen sey, wenn statt Holz Steinkohlen gebrannt werden, die zwar auch Funken ausströmen, welche jedoch schnell verlöschen und keinen Schaden thun.« 45
Auf der im Oktober 1842 eröffneten Berlin-Frankfurter Eisenbahn zogen die Loks sowohl Equipage-Wagen wie auch geschlossene Personenwagen und offene Stehwagen. Nachdem Mitte Juni 1843 heftige Regengüsse niedergegangen waren, berichtete das Frankfurter Patriotische Wochenblatt , die Passagiere in den Stehwagen wären »nicht nur mit ihren Sachen, die sie in Körben und Bündeln trugen, ganz und gar durchnäßt« worden, »sondern mußten auch zuletzt bis an den Knöcheln im Wasser stehen. Die Schweine, die auf der Eisenbahn transportiert werden, bekommen ein Strohlager und ein schützendes Obdach …« 46Der von der Presse aufgegriffene Unmut der Passagiere zeigte Wirkung: 1844 wurden die Stehwagen auf der Linie abgeschafft und durch geschlossene Wagen der dritten Klasse ersetzt.
Im Zuge der flotten Entwicklung des Schienenpersonenverkehrs nahmen die Fahrgäste von Beginn an mit ihren Erwartungen und ihrem konkreten Reiseverhalten nebst der dabei gemachten Erfahrungen durchaus Einfluss auf viele Aspekte des Eisenbahnbetriebs. Ihre Wünsche nach Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit trugen zweifellos zur Weiterentwicklung der Technik bei. Der Wunsch nach preiswerten Reisemöglichkeiten wurde von den Eisenbahngesellschaften auch erhört. Statt der anfangs nur zwei offerierten Klassen – eine für geschlossene und die andere für offene Wagen – wurden auf immer mehr Linien drei und zunehmend vier Klassen in geschlossenen Wagen zum Standard. Die erste und zweite Klasse für besser gestellte und gut betuchte Leute, die dritte und vierte für die weniger bemittelte Bevölkerung. In Preußen wurde die allgemeine Einführung der vierten Klasse mit der Begründung versehen: »Menschliche Arbeitskraft ist mit die am kostspieligsten transportirbare und am schwersten bewegliche Waare. Daher kommt es, dass immer noch eine nach Zeit und Verhältnissen zwar verschiedene, aber doch eine gewisse nicht unbedeutende Quantität dieses volkswirtschaftlichen Kapitals an einigen Orten feiert, oder nicht aufs höchste verwerthet wird, obgleich anderwärtz die erforderliche Gelegenheit dazu geboten ist, aber nicht wahrgenommen werden kann. […] Dieser Uebelstand begegnet jede Verbesserung im Verkehr und im Transport, welche die Beweglichkeit der Arbeitskräfte vermehrt und ihre Beförderung von Ort zu Ort erleichtert, beschleunigt und möglichst wenig kostspielig macht.« 47Im Laufe der Zeit wurde die vierte Klasse, die zur »Erleichterung der Communication« und »zur Förderung des Verkehrs« insbesondere der Arbeiterklasse zugedacht war, nicht zuletzt von Handwerkern, Auswanderern und dem Landvolk frequentiert, das mit großen Bündeln, Hühnern und Gänsen an Markttagen in die nächste Stadt fuhr. Bequem waren die vom Volksmund als »Kälberwagen« titulierten Anhänger während des 19. Jahrhunderts gewiss nicht, hatten sie doch lediglich an den Wagenwänden hochklappbare hölzerne Sitzbänke.
Die billige und von daher immer hoch ausgelastete vierte (Steh-)Klasse ermöglichte Leuten mit geringen Einkünften in der Tat das zumindest gelegentliche Mitfahren. Im Zusammenspiel mit der nicht minder hochfrequentierten dritten (Holz-)Klasse gewährleistete sie ab 1852 den Aufstieg der Eisenbahn zum Massentransportmittel. Reisen, die bis dahin von den meisten Leuten nur dann angetreten wurden, wenn sie wirklich erforderlich waren, wurden fortan allmählich zu so etwas wie einem Normalfall. Einschließlich der touristischen »Lustreisen«, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts im Bürgertum immer beliebter wurden. Peter Paul Dahms vermerkt zur »Streubreite in der Frequenz und der Länge der Reise«: »Der landwirtschaftliche Produzent fuhr regelmäßig eine kürzere Strecke von seinem Dorf in die nächste Stadt, wobei dabei noch ein längerer Fußweg zur nächsten Eisenbahnstrecke und deren Haltepunkt erforderlich werden konnten. Eine Zusammenkunft von Verwandten zu einem Familientreffen aus einem traurigen und weniger traurigen Grund konnte einmalig auch über eine größere Entfernung organisiert werden. Der Bildungsbürger konnte seiner Neugier oder seinem Erkenntnisdrang folgend, entfernte Landschaften und Städte besuchen. Der junge Adelige konnte seine ›Kavalierstour‹ mit der Eisenbahn absolvieren.« 48
Читать дальше