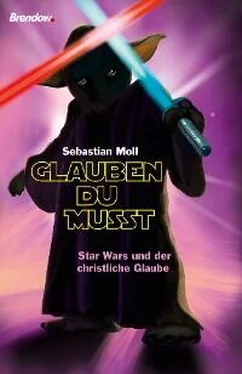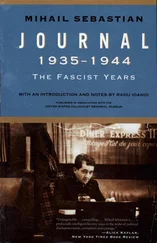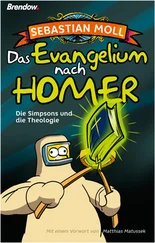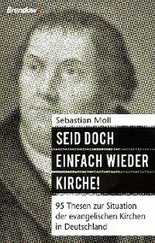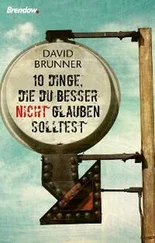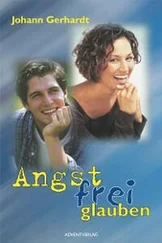Und doch muss man knapp 20 Jahre nach deren Zusammenbruch erst einmal jedem erklären, wer die Jedi waren und was es mit der Macht eigentlich auf sich hat! Luke Skywalker hat jedenfalls noch nie etwas davon gehört und muss es sich in aller Ruhe von Obi-Wan erläutern lassen. Aber auch dieser kann sich ja nicht einmal mehr an R2-D2 erinnern, obwohl der kleine Droide über 20 Jahre lang ein fester Bestandteil seines Lebens war. Nicht zuletzt sind auch die imperialen Offiziere völlig unwissend, machen sich gar lustig über den Glauben an die Macht. Als sich einer von ihnen der gewaltigen Möglichkeiten des Todessterns rühmt, weist Vader ihn zurecht: „Seien Sie nicht allzu stolz auf Ihr technologisches Schreckgespenst! Die Fähigkeit, einen ganzen Planeten zu vernichten, ist nichts gegen die Stärke, die die Macht verleiht.“ Der angesprochene Offizier, der im Film unbenannt bleibt, aber im Abspann als General Motti identifiziert wird, erwidert: „Verschonen Sie uns mit Ihrem Kinderschreck von der magischen Macht, Lord Vader. Ihre traurige Anhänglichkeit an diese altertümliche Religion hat Ihnen nicht geholfen, die gestohlenen Unterlagen herbeizuzaubern, und Sie ebenso wenig die geheimen Stützpunkte finden lassen …“ – woraufhin er Bekanntschaft mit Vaders legendärem Würgegriff macht wie auch mit dessen nicht minder legendären Worten: „Ich finde Ihren Mangel an Glauben beklagenswert.“ Hier zeigt sich übrigens bereits eine erste Parallele zwischen Vater und Sohn, die uns direkt hätte auffallen müssen. Als Han Solo über Lukes Training mit dem Lichtschwert spottet („Antiquierte Waffen und Religionen können es nicht mit einer guten Laserkanone aufnehmen“ – im Original bezeichnet er Lukes Religion als „hokey“, also Quatsch), entgegnet dieser in altklugem Tonfall: „Sie glauben wohl nicht an die Macht?“ Dass er selbst erst wenige Stunden zuvor das erste Mal davon gehört hat, hindert ihn offenbar nicht daran, nun arrogant auf die ‚Ungläubigen‘ herabzublicken. Zwar gelingt ihm wenig später eine erste Demonstration seiner neuen Fähigkeiten, indem er blind die Schüsse einer Roboterkugel abwehrt, doch hat diese Demonstration leider nicht denselben Effekt wie ein telekinetischer Würgegriff, weshalb Han Solo vorerst auf seiner Skepsis beharrt: „Ich nenne es Glück.“ Natürlich dienen solche in den Film eingebauten Erklärungen in erster Linie dem Publikum. Bis 1977 hatte ja tatsächlich noch nie jemand von den Jedi oder der Macht gehört. Dennoch gibt es, sagen wir mal, geschickte und weniger geschickte Wege für solche erzählerischen Notwendigkeiten. In Mel Brooks Star-Wars-Parodie
Spaceballs (1987) werden diese etwas unbeholfenen Versuche dann auch geschickt aufs Korn genommen. Nachdem Colonel Sandfurz dem furchteinflößenden Lord Helmchen ausführlich die gemeinsamen Eroberungspläne erläutert hat, wendet sich dieser, der besagte Pläne natürlich längst kannte, zum Publikum und fragt: „Haben das alle verstanden?“
Vielleicht ist die weitverbreitete Ablehnung gegenüber der Macht, die sich sowohl bei Han Solo als auch bei General Motti findet, aber auch nur ein Sinnbild für die Ablehnung gegenüber Religion im Allgemeinen, die uns auch in unserer Welt mehr als geläufig ist – entweder, weil wir sie selber verspüren, oder weil wir als religiöse Menschen damit leben müssen. Interessanterweise repräsentieren Han Solo und General Motti, trotz ihrer gemeinsamen Verachtung, zwei unterschiedliche Menschentypen und somit auch zwei unterschiedliche Charakterzüge, die zu ebendieser Verachtung führen. Han Solo ist der typische Draufgänger, der sich nach Abenteuer und Unabhängigkeit sehnt. Die Vorstellung, anderen gehorchen zu müssen, ist ihm zuwider. Daher reagiert er auch gereizt auf die Anordnungen von Prinzessin Leia: „Hören Sie, Hochwohlgeboren, eins wollen wir doch mal klarstellen: Ich nehme nur von einem Menschen Befehle entgegen. Von mir!“ Auch in der oben bereits erwähnten Szene mit Luke Skywalker kommt diese Haltung deutlich zum Ausdruck: „Junge, ich bin von einem Ende dieser Galaxis bis zum anderen geflogen. Ich habe allerhand merkwürdige Dinge gesehen, aber noch nie etwas, das mich davon überzeugt hat, dass es eine allmächtige Macht gibt, die alles beherrscht. Mein Schicksal jedenfalls wird nicht von einem mystischen Energiefeld beherrscht. Nichts als simple Tricks und Unsinn.“ Han möchte Herr seines eigenen Schicksals sein, Unterordnung ist seine Sache nicht. Menschen mit einer solchen Einstellung haben auch in unserer Welt eine kritische bis ablehnende Haltung gegenüber der Religion, besonders gegenüber den monotheistischen. (Der Einfachheit halber ist im Folgenden mit dem Begriff ‚Religion‘ immer ‚monotheistische Religion‘ gemeint.)
Dem Islam wird zuweilen vorgeworfen, sein Name bedeute „Unterwerfung“. Bedenkt man die vielen negativen Assoziationen, die der Islam in unserer heutigen Diskussionskultur weckt, mag dieser Vorwurf berechtigt erscheinen, doch im Grunde ist diese Wortbedeutung nichts weiter als eine Banalität. Religion bedeutet immer Unterwerfung, Unterwerfung unter den Willen Gottes. Auch ein Christ würde dies nicht anders beschreiben. „Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe“, diese Worte Jesu im Garten Gethsemane, die er spricht, nachdem er seinen Vater zuvor angefleht hat, den Todeskelch an ihm vorübergehen zu lassen, zeugen von der völligen Ergebenheit in den Willen des Vaters. Er war hierin ein Vorbild, ein unerreichbares zwar wie in so vielem anderen auch, aber dennoch ein Vorbild. Durch ihn und mit ihm können Christen lernen, sich von Gott ergreifen zu lassen und ihren Willen in seinen dahinzugeben.
Für Menschen, die sich selber als rebellisch definieren, ist eine solche Haltung kaum zu ertragen. Das ist einer der Gründe, warum sich pubertierende Jugendliche nur selten für Kirche und Christentum begeistern können. Letzten Endes steht jede Form von Emanzipation – und die Pubertät ist eine solche – der Forderung nach Unterwerfung entgegen. Der Begriff leitet sich vom lateinischen emancipatio ab und bezeichnete im römischen Recht die Entlassung bzw. den Freikauf des Sohnes aus der väterlichen Gewalt. Gibt es eine bessere Bezeichnung für die Abwendung von der Religion als den Sohn, der sich aus der Herrschaft des Vaters lösen will? Jesus selbst greift dieses Motiv in einem seiner berühmtesten Gleichnisse auf, dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. In dieser Geschichte lässt sich der jüngere Sohn von seinem Vater seinen Vermögensanteil auszahlen (Emanzipation) und verlässt seine Familie, um das Geld in fernen Ländern zu verprassen. Später kehrt er verarmt und reuig zurück: „Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen; mache mich zu einem deiner Tagelöhner!“ Doch sein Vater hat Erbarmen und heißt ihn fürstlich willkommen: „Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; und er war verloren und ist wiedergefunden worden.“
Die Menschheitsgeschichte beginnt bereits mit einem Emanzipationsprozess. Adam und Eva rebellieren gegen das Gebot des Herrn, weil sie selber sein wollen wie Gott. „Gott und sein Rebell“, so bezeichnete der Theologe Emil Brunner (1889-1966) treffend das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Es gehört zu unserer Natur, uns gegen Gott und seine Gebote auflehnen zu wollen, Adam hat uns diese Veranlagung vererbt, wir nennen sie Sünde. Doch ähnlich wie der verlorene Sohn wird Adam von Gott nicht völlig verworfen, wenngleich auch nicht ganz so freundlich behandelt wie der Sohn in dem Gleichnis. Für ihn gilt eher die Weisung aus den Sprüchen Salomos: „Denn welchen der HERR liebt, den straft er, und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn.“ Letzten Endes handelt die gesamte Bibel von diesem einen Thema: Der Mensch, der sich leichtfertig von Gott losgesagt hat und sich nun nach der Wiedervereinigung mit dem Vater sehnt (siehe Kapitel VI).
Читать дальше