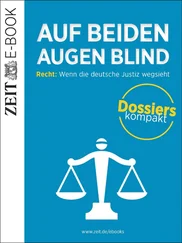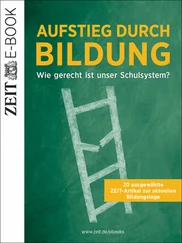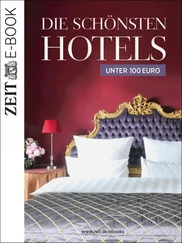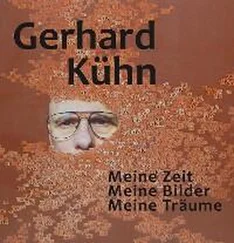1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 Was einzig fehlte war ein Bambino, ein Stammhalter, obwohl der Italiener hundertfach versprochen hatte, seiner Angebeteten zu zeigen, wie man Tango im Liegen tanzt. Ein Knäblein sollte es werden, das einmal übernehmen sollte, wofür sich seine Erzeuger krumm gelegt hatten. Doch ein solcher Kronprinz wollte und wollte sich, porca miseria, nicht einstellen.
Angesichts dieses einzigen Wermutstropfens im Goldpokal des Schaumlöffl-Lavarone-Kartells meldete sich, zuerst ganz zart, so etwas wie Trübsal im Gemüt der Rotwangigen. Die Trübsal nahm, wie Madame, zu, denn Madame begann, Pillen zu schlucken, die ihr ob einer beginnenden Schwermut die Frauenärztin verordnet hatte. Doch alles was beruhigt, macht dick, hatte die Frau Doktor dunkel aber wahrheitsgetreu geraunt, und so geriet Madame Schaumlöffl allmählich zur Madame Dampfnudel. Die fachärztliche Erkenntnis, dass die Kinderlosigkeit nicht etwa ihrer weiblichen Infertilität geschuldet war, sondern am kalten Samen von Signore Lavarone lag, erschütterte die geschäftlich überaus erfolgreiche Zuckerbäckerin zutiefst. Dieser ganz mit seinen diversen Posten, Pöstchen und Gschaftlhubereien, sehr diskret freilich auch mit seiner neuen Sekretärin beschäftigte Tausendsassa hielt das für eine glatte Fehldiagnose meiner Tante Mirtel, unterstellte ihr überdies allerlei böse Absichten und Hintergedanken, nannte sie selbst eine vertrocknete Spinatwachtel, und begann, sich – als Gegenbeweis – hormonell auszutoben, so dass ihm bald der Spitzname „Häuptling offene Hose“ vorauseilte. Weibliches Personal wollte nicht länger mit ihm alleine im Treppenhaus sein. Dafür stieg sein Ansehen an den Stammtischen, und es wirkte sich auf die Inhalte sowie die sprachliche Ausgestaltung diverser Herren- und Kasinowitzchen aus.
Auf dem Höhepunkt seiner wirtschaftlichen und politischen Karriere, als schon der Einzug in den Bayerischen Landtag unmittelbar bevorstand, welchselbiger nur als eine Vorstufe zum Rang eines Staatssekretärs oder gar Ministers gedacht war, ereilte Stefano Lavarone, den gelernten Hausierer in Sachen Damenunterwäsche, ein schwerer Schicksalsschlag in Gestalt einer frühreifen Fünfzehnjährigen, deren geradezu sensationell zu nennende körperliche Entwicklung zahlreiche Herren der Gemeinde wohlwollend und aufmerksam beobachtet und naturgemäß wortreich mit einschlägiger Terminologie kommentiert hatten.
Das überwiegend kurzberockte Wesen mit unendlichem langem, edel geformtem Fahrgestell und beträchtlich ausgefüllten Pullovern respektive Blusen war als Lehrmädel in der Zuckerbäckerei von Madame Schaumlöffl angestellt. Dorthin aber, wohin es den Milanese zog, ruhte die Hand des Staatsanwaltes, die der Südländer in rauschhafter Wallung flugs beiseiteschob, denn ihm war noch kein noch so enges Tor verschlossen geblieben.
Wer hier wen wozu verführt haben mag, bleibe dahingestellt. Jedenfalls stellte meine Tante Mirtel als Hausärztin von Madame Schaumlöffl, die sich von Anfang an aus einem angeborenen mütterlichen Instinkt heraus des naiven Vögelchens angenommen hatte, nach einer kurzen Untersuchung routiniert und zweifelsfrei fest, dass ein Braten in der Röhre, Nachwuchs in Sicht und das junge Ding in der Hoffnung war.
Lavarone, der unter Heulen und Haareraufen ein melodramatisches häusliches Geständnis ablegte und dabei den Verführten, ja den Hereingelegten mimte, schlug seiner Holden vor, das Lehrmädel zu adoptieren, doch Madame Schaumlöffl lehnte es ab, auf einen Schlag Mutter und Großmutter zugleich zu werden, denn immerhin würde Lavarone dann seine – wenn auch adoptierte – Tochter geschwängert haben.
Im Blauen Land bleibt ein Geheimnis nicht lange geheim. Als die Sache ruchbar wurde und staatsanwaltliche Briefe ins Haus flatterten, legte der Gemeinderat dem Vorsitzenden des Bauausschusses nahe, von seinem Amt zurückzutreten. Überhaupt wurde das Wort „Rücktritt“ jetzt der wichtigste Begriff in der einstmals so steil bergauf führenden Karriere des Stefano Lavarone. Es ging nämlich von jetzt auf gleich bergab. Und zwar rasant. Binnen Jahresfrist kam es nicht nur zu einer Taufe, sondern auch zu einem Gerichtsverfahren, dem ein Scheidungsprozess folgte.
Madame Schaumlöffl nahm die junge Mutter und deren Leibesfrucht, einen prachtvollen glutäugigen Jungen mit südländischem Einschlag, unter ihre großmütterlichen Fittiche, fühlte sich endlich am Ziel ihrer fraulichen Wünsche, denn sie hatte nun Kind und Kindeskind, die Nachfolge der Zuckerbäckerei war gesichert, das vormals naive Vögelchen entwickelte sich zur tüchtigen Geschäftsfrau, blieb solide und schickte ihren Sprössling mit Omas finanzkräftiger Unterstützung bald auf ein teures Internat irgendwo am Genfer See.
Lavarone wurde verurteilt, nahm das Urteil unter Heulen und Zähneknirschen an, verzichtete auf Revision, erhielt jedoch nie Besuch im Gefängnis, wo er sich bald die einflussreiche Position eines Kalfaktors erquasselte. Nachdem er seine Strafe abgesessen hatte, verließ er um etliche Jahre und einige Erfahrungen reicher das Blaue Land just mit jenem Musterkoffer in der Hand, mit dem er einst eingezogen war. Man hat nie mehr etwas von dem Mann mit der flinken Zunge gehört, denn die Zeit der Hausierer in Sachen Damenunterwäsche war abgelaufen.
Furi heißt man nicht, Furi war nur der Spitzname. Der richtige Name von Furi war Siegfried: wie zum Hohn, denn er war alles andere als ein blonder germanischer Held und Nibelunge. Er war ein zaunlattendürres Büblein mit einem blassen Gesicht, das wie aus Knetmasse schien und aus dem ungewöhnlich brennende Augen leuchteten, die in merkwürdigem Kontrast zu einem abscheulich fuchsroten Haarschopf standen, der in diversen Wirbeln aus einem offensichtlich zu klein gebliebenen Schädel spross. Mit seinen Eltern wohnte er über der Freibank, wo es nach Schweineblut roch und nach frisch Geschlachtetem. Man hätte meinen können, Furis Vater sei der bei der Gemeinde angestellte Metzger gewesen, dem eine Dienstwohnung unmittelbar über seinem Arbeitsplatz zustand, doch dieser Mann war mit nur einem Arm aus dem Krieg heimgekehrt und übte jetzt einen der am tiefsten verachteten Berufe aus. Er war Fremdenführer. Ein einarmiger Fremdenführer, der den Kurgästen im stets ein wenig feuchtfröhlich klingenden rheinländischen Singsang die erbärmlichen Sehenswürdigkeiten des Ortes, worunter eine Burgruine sowie eine zerfallende Hammerschmiede zählten, und den kürzesten Weg zwischen den Gasthöfen zeigte. Das kam in Rang und Ansehen gleich hinter Zigeuner, Scherenschleifer, Kesselflicker und Abdecker. Und die Wohnung über der Freibank gehörte bei der Gemeindeverwaltung zur Abteilung Armenhaus.
Seinen Spitznamen verdankte Furi nicht etwa jenem schwarzen Pferd, das seinerzeit erstmals in die deutschen Wohnzimmer galoppierte, in denen bereits ein Köter namens Lassie neben dem ewig schwadronierenden Luis Trenker und seinem Geschwafel vom Herrgott und der Steilwand Raum gegriffen hatte. Nein, der schmächtige Siegfried, den die stolzen und reichen Bauernsöhne des Ortes einen Magermilchkrüppel nannten, hieß Furi, weil sein Familienname Fuhrmann lautete. Ein Fuhrmann aber konnte nur ein Bauer mit einem eigenen Gaul sein, und davon war der einarmige Fremdenführer unerreichbar weit entfernt. So wurde aus dem Fuhrmann eben bloß ein Furi, dessen gleichfalls magere und stets kränkliche Mutter in den Wirtshäusern spülte und die Latrinen reinigte.
Es war damals üblich, alles, was nicht aus dem Dorf stammte, klein zu machen, aber auf die Idee, den Siegfried beispielsweise auf einen Siggi zu stutzen, ist keiner gekommen. Diejenigen, die man verachtete, die nannte man beim Familiennamen. Die christlichen Vornamen blieben den Besitzern der Felder, der Wälder und der Fremdenpensionen vorbehalten. Wer etwas besaß, der hatte auch einen Vornamen. Etwas zu besitzen war eben die Voraussetzung dafür. Ohne Besitz blieb man namenlos, und statt des verballhornten Familiennamens hätte es auch die Hausnummer getan, aber die Freibank hatte keine Hausnummer, denn sie war ja nichts weiter als eine gemeindeeigene Einrichtung zum Verkauf von minderwertigem, deshalb im Preis erheblich herabgesetztem Fleisch, das sich Notschlachtungen verdankte. Der Fleischbeschauer, meist der Bezirksveterinär, hat es in der Regel nur als „bedingt tauglich“ eingestuft, und was nicht über die Ladentheke ging, wurde zu Hundefutter verarbeitet. Gekauft wurde das billige Freibankfleisch von den kleinen alten Leuten mit den schmalen Kriegs- und Versehrtenrenten, Armenhäuslern mithin, die dafür auch noch Schlange stehen mussten, damit auch jeder sie begaffen konnte.
Читать дальше