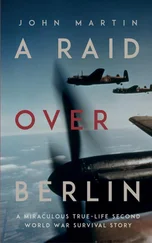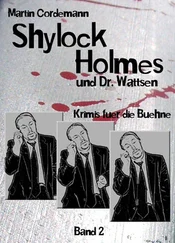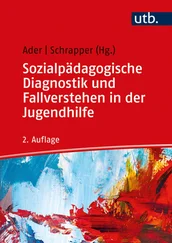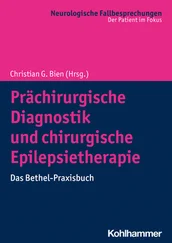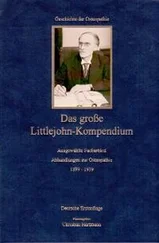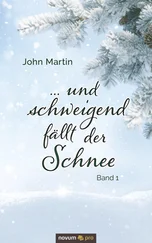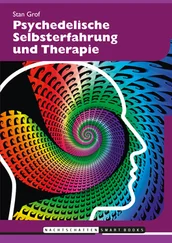1. Zirkulation
2. Respiration
3. Nutrition
Die zirkulatorische Behandlung durch Beschleunigung des Herzschlags wird über eine Behandlung im Bereich Th3–Th4 erreicht. Th4–Th5 repräsentieren den Kommunikationspunkt zwischen den oberen und den unteren Teilen des Körpers. Der Herzschlag kann auch vom mittleren zervikalen Bereich aus beschleunigt und über den pneumogastrischen Nerv im Bereich des Ganglion cervicale superius gehemmt werden. Gleiches gilt für die Stimulierung des Ganglion cervicale inferior. Die respiratorische Behandlung besteht im Anheben der Rippen und in einer Stimulierung der lungenrelevanten vasomotorischen Nerven im Bereich Th3–Th7.
Bei der nutritiven Behandlung stimuliert man den Magen im Bereich Th4–Th5 sowie Th6–Th7, wobei Letztere den Magenausgang repräsentieren. Stimulieren Sie auch die Leber im Bereich Th6–Th10 auf der rechten Seite. Die Karbonisierung des Blutes wirkt als Reiz. Der gewöhnliche Typ der Diarrhö geht auf hyperkarbonisiertes Blut zurück. In diesem Fall hemmen Sie die zervikal gerichteten Impulse.
KLASSIFIKATION DER ERKRANKUNGEN
1. Infektionserkrankungen, einschließlich Fieber
2. Erkrankungen des respiratorischen Systems
3. Erkrankungen des Blutes, des Herzens und der Zirkulation
4. Erkrankungen des Verdauungssystems
5. Erkrankungen der Leber, der Milz und des Pankreas
6. Erkrankungen des ableitenden Systems
7. Erkrankungen des Bluts im Sinne eines Gewebes
8. Erkrankungen des Nervensystems
9. Erkrankungen der Haut
10. Erkrankungen von Rektum und Anus
11. Erkrankungen des Auges, des Ohrs, der Nase und des Rachens
12. Erkrankungen der Knochen und Gelenkverbindungen
13. Erkrankungen des Muskelsystems
14. Erkrankungen paralytischen Typs
15. Geschlechtserkrankungen
16. Geburtshilfe und Gynäkologie
17. Zahnerkrankungen, Psychiatrie
18. Physische Diagnose und Behandlung
FIEBER 16
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN
1. Anstieg der Temperatur; physiologisch
2. Veränderung der Funktionsweise, Reaktion; Hyperphysiologie
3. Veränderung der Struktur, Pathologie
Bei der Untersuchung des zervikalen Bereichs beginnen Sie am Atlas, wobei Sie zuerst eine oberflächliche und im Anschluss daran eine tief gehende Untersuchung in umgekehrter Richtung vornehmen. Bei Atlas und Axis vergleichen Sie die relative Position. Befindet sich der Atlas zu stark anterior:
Palpieren Sie die Musculi sternocleidomastoideus und trapezius. Lokalisieren Sie die Schilddrüse mittels ihres Isthmus. Untersuchen Sie die Klavikula.
Um an die linke Seite der 2., 3. und 4. Rippe heranzukommen, legen Sie Ihre Arme um den Patienten und ziehen die Skapulae heraus, bis Sie die linke Seite finden. Untersuchen Sie in schräger Linie von der 2.–6. Rippe den perikardialen Ton, der an der 6. Rippe am stärksten sein wird. Begleitet ihn ein pfeifender Ton, indiziert dies das Vorhandensein perikardialer Flüssigkeit. 17
Untersuchen Sie die Organe im abdominalen Hohlraum – platzieren Sie die Hände im Becken so weit wie möglich nach unten und ziehen Sie die Organe nach oben, wobei Sie deren Bewegung beobachten, insbesondere das aufsteigende und absteigende Kolon, das quer liegende Kolon und das Pankreas.
Gleich zu Beginn möchten wir betonen, dass zwischen Temperatur und Fieberzuständen klar unterschieden werden muss. Zweifellos hat Graves Recht, wenn er sagt:
„Im gesamten Spektrum menschlicher Leiden gibt es keine Erkrankung, die so außerordentlich interessant und bedeutend ist wie Fieber.“
Ob in höchst zivilisierten oder in wenig entwickelten Ländern, in urbanen oder in ländlichen Regionen, in Berggegenden oder in flachen Gebieten: Fieber kommt überall vor – aber über kaum einen Befund kursieren derart wirre Meinungen wie über diesen. Die alten Ärzte sagten: Essentia vero februm est praeter naturam caladitas 18, weil man sie gelehrt hatte, ein Symptom allein zu betrachten. Hautwärme oberhalb der normalen, Gesundheit entsprechenden Temperatur galt als synonym mit jenem fiebrigen oder pathologischen Befund, der zu Fieber gehört. Vor allem in solchen Fällen muss aber mehr Gewicht auf die Ätiologie als auf die Symptome gelegt werden. Sogar der berühmte Virchow definiert Fieber als
„[…] jene körperliche Verfassung, in dem die Temperatur über das normale Maß steigt.“
Obgleich wir Virchows unangezweifelte Autorität als Pathologe ersten Ranges anerkennen, weigern wir uns, diese Definition zu akzeptieren, denn hier wird offensichtlich Wirkung mit Ursache und Physiologie mit Pathologie verwechselt.
Es kann durchaus zu einer über den Normalzustand hinausgehenden Temperaturabweichung nach oben kommen, ohne dass es sich dabei um Fieber handelt. Extreme Kälte oder Hitze, der man über längere Zeit ausgesetzt ist, ständiger Aufenthalt in tropischen Regionen, exzessives Essen oder Trinken – insbesondere von Stimulanzien – sowie exzessive und lang andauernde Bewegung können die Temperatur verändern, ohne notwendigerweise Fieber hervorzurufen. Freilich können sich derartige Temperaturen auch zu messbarem Fieber entwickeln. Es besteht jedoch keine unbedingte Korrelation. Wenn also das Thermometer einen Temperaturanstieg anzeigt, ist das noch kein zuverlässiges Anzeichen für Fieber.
Dr. Soullier berichtet in einer neueren Ausgabe des Lyon Medical vom Fall einer jungen Frau unter 30, bei der über drei aufeinander folgende Tage ein Temperaturanstieg auf 43,8 Grad Celsius festgestellt wurde, ohne dass Fieber oder ein verstärkter Puls bestand. Ohne irgendeine vorhergehende hysterische Krankengeschichte verfiel sie plötzlich in einen narkoleptischen Schlaf. Der Schlaf zeichnete sich durch seine Tiefe aus, der Puls war normal, die Extremitäten waren entspannt und die Pupillen kontrahiert. Es bestand keine anomale Hauttemperatur, doch die vaginale Temperatur betrug 42,7 Grad Celsius. Die Patientin erhielt ein zehnminütiges Bad von 28 Grad Celsius. Dadurch fiel die Temperatur zwar zunächst auf unter 40 Grad Celsius, sie stieg aber danach bald wieder auf über 43,8 Grad Celsius. Die Hautoberflächen fühlten sich noch heißer an als zuvor, der Puls betrug 84. Die Patientin erhielt ein weiteres, 15-minütiges Bad von gleicher Temperatur wie beim ersten Mal. Ihre Körpertemperatur fiel dadurch auf etwa 37,8 Grad Celsius, stieg aber am nächsten Tag erneut auf 44 Grad Celsius und hielt an, bis die Patientin nach einem 36-stündigen Schlaf erwachte. Beim Erwachen hatte sie das Problem, das dem Beginn des Anfalls vorausgegangen war, völlig vergessen. Es bestand keine Fiebrigkeit, kein anomaler Harnbefund, lediglich ein leicht beschleunigter Puls. Am vierten Tag erhielt die Patientin ein drittes Bad von gleicher Temperatur wie zuvor, woraufhin ihre Körpertemperatur auf 41,1 Grad Celsius fiel. Am sechsten Tag sank die Temperatur und lag nun leicht unter den Normalwert. Soullier betrachtet dies als einen reinen Fall von Hyperthermie ohne irgendwelche anderen Fiebersymptome.
Weitere interessante Fälle reiner Hyperthermie im Zusammenhang mit dem Beginn eines Anfalls von Blutspucken sowie bei Meningitis, Peritonitis, Erkältungen usw. hat Cuzin präsentiert.
Ist die Temperatur fiebrig, steht sie diagnostisch für Fieber. Warum entsteht diese fiebrige Temperatur? Sie ist zweifellos verbunden mit einem Fehlen der Nervenkontrolle, die im physiologischen Zustand die Gewebe vor exzessiven Oxidationsprozessen schützt. Bei Fieberzuständen fehlt diese Nervenkontrolle oder verliert ihr Gleichgewicht, was wiederum einen Temperaturanstieg auslöst und zur Zerstörung oder Behinderung der Nervenregulation führt. Was genau zerstört, bremst oder behindert diese Nervenkontrolle? Möglicherweise sind es Bakterien bzw. deren Produkte, die sich in den Geweben befinden bzw. ins Blut übergehen, von dort in die Nervenzentren gelangen und diese dann irritieren. Eventuell sind aber auch die Gewebe bei Erkrankung betroffen und die davon ausgehende Reflexirritation beeinflusst die Nervenzentren. Auch traumatische Zustände oder Läsionen können die Nervenkraft vom Flüssigkeitskreislauf abschneiden, wodurch die Gewebe in Fehlernährung geraten, der in der gleichen Reflexirritation der Nervenzentren resultiert. Man hat z. B. festgestellt, dass septische Abflüsse von Wunden, Abszessen usf., die von der Nervensubstanz absorbiert werden, einen Temperaturanstieg hervorrufen können und dass die direkte Verletzung des Nervenzentrums auch ohne irgendeine äußere Ursache eine Fiebertemperatur herbeiführen kann. In beiden Fällen stört die resultierende Temperatur die gesunde Balance des Lebens und kann den Körperorganismus später in einen Fieberzustand versetzen.
Читать дальше