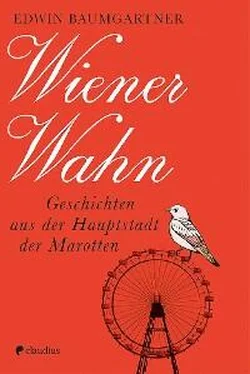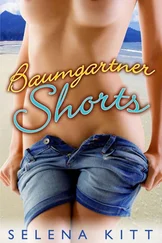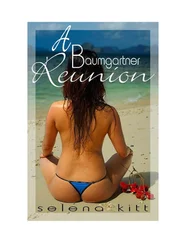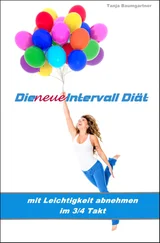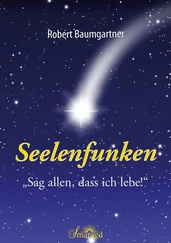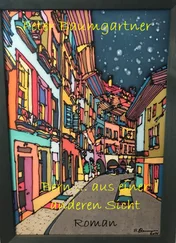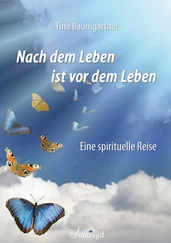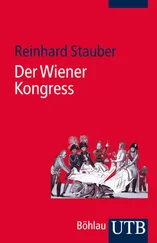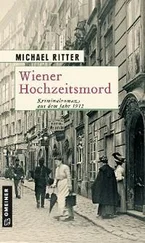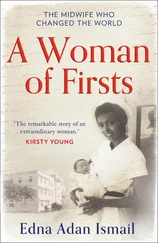Die Tante Friedl weiß sich keinen Rat mehr, und der Hans auch nicht, also muss man doch ans Ordnungmachen gehen.
Am Wochenende haben die beiden keine Lust dazu, am Montag mag die Tante Friedl nicht, und am Dienstag verschiebt sie die freudlose Arbeit auf Mittwoch. Allerdings steht der Piwonka schon am Dienstagabend wieder vor der Tür. Diesmal macht ihm der Hans auf. „Kontrolle“, schnarrt der Piwonka und schiebt sich an ihm vorbei. Die Tante Friedl kommt nicht einmal dazu, dem Piwonka ein Stamperl Schnaps und ein Grammelschmalzbrot anzubieten, fängt der Piwonka gleich zu schnarren an, jetzt sei, äh, der Putzkurs fällig, daran führe, äh, kein Weg vorbei. Das ganze Bitten von der Tante Friedl nützt nichts. Der Hans resigniert gleichfalls. Er legt der Tante Friedl die Hand auf die Schulter und singt sozusagen tröstend vor sich hin: „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.“ 25
Da geht ein Ruck durch den Piwonka. „Des is aus da ,Fledamaus‘“, schnarrt er ohne ein einziges Äh. Und dann stimmt er an: „Bist du’s, lachendes Glück“, und so schnarrend seine Stimme beim Sprechen ist, so geschmeidig klingt sie, wenn er singt. „Das ist aber ,Der Graf von Luxenburg‘ vom Lehár“, sagt der Hans.
„Sowieso“, sagt der Piwonka. Dann singt er die ganze Nummer so schön vor, dass der Lehár seine Freude dran hätt’.
„An Ihnen ist ein Tenor verloren gegangen“, sagt der Hans.
„I woet, äh, Schauschbüla wean“, schnarrt der Piwonka, „owa mia hom ka Gööd ghobd fia goa nix. Jetzd schleich i mi maunchmoe ins Buagdeata eine oda, äh, in a aundas Deata. Wissen S, fia mi is da ,Faust‘ des greßte.“
Jetzt geht ein Ruck durch den Hans. „Für mich auch“, sagt er und beginnt:
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein;
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.
Der Piwonka schnarrt: „Ostaschbaziagang. Kenn i.“ Und dann fährt er mit seiner schönen Stimme, mit der er gesungen hat, und in fast makellosem Hochdeutsch, dem man nur an manch einem Wort den Angehörigen der Arbeiterklasse anhört, mit dem Wagner fort:
Mit Euch, Herr Doktor, zu spazieren,
Ist ehrenvoll und ist Gewinn;
Doch würd’ ich nicht allein mich her verlieren,
Weil ich ein Feind von allem Rohen bin.
„I kaun den ,Faust‘ auswendig“, schnarrt der Piwonka, „hoed net gaunz, valleicht, owa fost.“
Was sich daran anschließt, ist keine Belehrung über Ordnung. Die drei unterhalten sich über das Theater und über Operetten, sie streuen Monologe ein und singen Melodien an, und alles geht durcheinander, weil allen der Mund übergeht, und der Piwonka ist selig, weil er endlich jemanden gefunden hat, mit dem er über seine geheime Leidenschaft reden kann, und die Tante Friedl ist selig und der Hans ist auch selig, weil sie unter ihren Freunden und in ihren Familien niemanden haben, mit dem sie ihre Freude an Operette und Theater teilen haben können.
Dann aber stellt zu guter Letzt die Tante Friedl doch die bange Frage, was jetzt mit der Ordnung und dem Putzkurs ist. „A wos“, schnarrt der Piwonka, „owa san S so guat und mochn S, äh, wiaklech sauwa, weu i söwa kaun zwoa a Äugal zuadruckn, owa waun a aundara kummt, dea waaß von ana Faust nua, wia ma s auffehoet 26.“
Die Tante Friedl hat dann wirklich saubergemacht und ein bisserl aufgeräumt. Ab und zu ist sie unterwegs, auf dem Areal von Sandleiten, dem Piwonka begegnet. Meistens hat er ganz normal gegrüßt mit „Hawe d Ehre“, aber wenn er sozialistisch gegrüßt hat mit der Faust, hat die Tante Friedl gewusst, dass er auf eine Inspektion vorbeikommt. Dann hat sie die mittlerweile blitzblanke und aufgeräumte Wohnung noch ein bisserl sauberer gemacht. Und bei den Inspektionen hat der Piwonka nie wieder auch nur herumgeschaut, sondern hat sich gleich in Positur geworfen und eine Operettennummer gesungen oder eine Stelle aus dem „Faust“ zum besten gegeben.
Wie dann die Nationalsozialisten gekommen sind, hat sich ihnen der Piwonka zuerst begeistert angeschlossen, aber es hat nicht lang gedauert, und er ist in den Widerstand gegangen, so wie der Hans, der auf einem Aug blind von der Front zurückgekommen ist. Nach dem Krieg ist der Piwonka zu den Kommunisten gegangen, weil er in ihnen die Garanten gegen ein Wiedererwachen des Nationalsozialismus gesehen hat, und der Hans und die Tante Friedl sind für die Amerikaner gewesen, weil sie der Auffassung waren, das stärkste Gegengift gegen den Nationalsozialismus ist die Demokratie. Aber die drei haben sich weiter getroffen und ihre eigenen Operetten- und „Faust“-Abende veranstaltet. Richtige Freunde sind sie geworden über alle Gegensätze und Grenzen hinweg.
Apropos Tante Friedl und kaisertreu: Also die Kaiser – ich sage Ihnen …
Jetzt muss ich Ihnen was erzählen, und zwar über die Kaiser.
Vom Nandl werden wir noch gesondert reden – Sie wissen eh, der Ferdinand I., der so ein bisserl seltsam gewesen ist. Von den Habsburgern haben ja viele einen Pecker gehabt, nicht nur der Ferdinand, auch etliche der anderen Kaiser sind G’spritzte 27gewesen.
Jetzt wett’ ich mit Ihnen um einen Apfelstrudel, den ich hier sehr empfehlen kann, dass Sie an die Habsburger denken. Recht so. Wenn es heißt: „österreichische Kaiser“, hat jeder ein Bild vom Franz Joseph vor Augen und von der Maria Theresia, obwohl die ihr Leben lang nur eine Erzherzogin gewesen ist. Der Kaiser, das ist ihr Mann gewesen, der Franz I. Stephan, ein Lothringer. Genau genommen, ist damit die Linie der Habsburger-Kaiser unterbrochen. Aber wenigstens ist eine Habsburgerin die Frau vom Kaiser gewesen, gerade so, wie eine Frau von einem Arzt in Wien eine Frau Doktor ist, sogar dann, wenn sie selbst was ganz Anderes studiert hat, meinetwegen Architektur, womit sie eine Frau Diplomingenieur wäre, oder Altphilologie, was sie zu einer Frau Magister machen würde. Aber wenn sie einen Arzt heiratet, ist sie eine Frau Doktor. Grad so ist die Maria Theresia eine Kaiserin gewesen.
Jo, eh, die Lektorin meines Vertrauens sagt auch immer, ich soll darauf nicht gar so herumreiten, grad heute geht es doch um Gleichberechtigung, was ich ja gut finde, aber ich kann deshalb doch, und wenn ich es noch so möchte, eine Erzherzogin nicht zu einer Kaiserin machen, nicht einmal dann, wenn sie selber sich so gefühlt hat und die Geschichte eher sie verzeichnet als ihren Mann.
Nach dessen Tod ist ihr Sohn Kaiser geworden. Jetzt hat die Dynastie halt Habsburg-Lothringen geheißen. Merken Sie was? „Habsburg“ steht an erster Stelle, obwohl der Franz Stephan gerade nach damaligem Verständnis zuerst kommen hätte müssen, und der ist, wie ich Ihnen gerade erzählt habe, ein Lothringer gewesen. Da hat’s also doch sowas Ähnliches gespielt wie Gleichberechtigung. Aber kommen wir zum Sohn von der Erzherzogin Maria Theresia und ihrem kaiserlichen Gemahl – der, der Sohn, meine ich, war nämlich ein rechter Spinner.
Dabei gilt der Joseph II. 28als der große Reformer unter den Kaisern. Das ist er bestimmt gewesen. Er hat keinen Stillstand geduldet. Selbst ist er inkognito als „Graf von Falkenstein“ in der Kutsche durch Europa gereist und hat sich angehört, was die Probleme der Menschen sind. In seinen Verordnungen hat er sich strikt an der Nützlichkeit orientiert. Zum Beispiel: Sind religiöse Auseinandersetzungen nützlich oder schaden sie dem Zusammenleben aller? – Also Religionsfreiheit. Oder: Was bringen Folter und Todesstrafe? – Ergo schafft er beides ab 29. Wer produziert mehr und besser: Ein Bauer, der auf eigene Verantwortung arbeitet, oder ein Leibeigener? – Also weg mit der Leibeigenschaft.
Soweit ist alles bestens. Aber mit den Auswüchsen seiner Kontrollsucht sind die wenigsten zurechtgekommen. Ich meine: Es ist ja schön, wenn sich der Kaiser höchstpersönlich um die Einzelheiten der Staatsgeschäfte kümmert, aber muss er gleich auch die Zahl der Kerzen regeln, die bei einem Gottesdienst entzündet werden? Den Komponisten hat er untersagt, lange Messen zu schreiben. Das mutwillige Schreien und Händeklatschen auf der Gasse hat er per Gesetz verboten, er hat bestimmt, wieviel Petersilie in der Küche von Schloss Schönbrunn verbraucht werden darf, und er hat sich für straffällig gewordene Adelige eine besondere Buße einfallen lassen: Sie mussten die Straße kehren. Obendrein hat er für die Theater angeordnet, dass kein Stück ein tragisches Ende haben darf. William Shakespeares „Romeo und Julia“ beispielsweise endet mit dem Wiener Schluss in einer fröhlichen Hochzeitszeremonie. Schmähohne.
Читать дальше