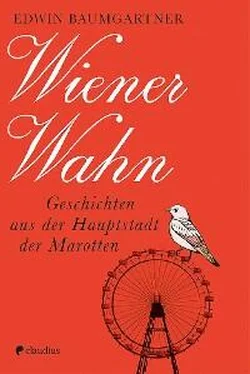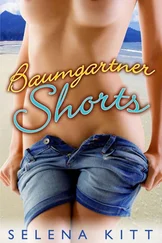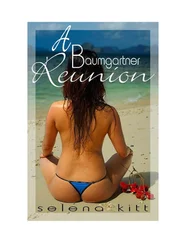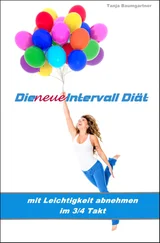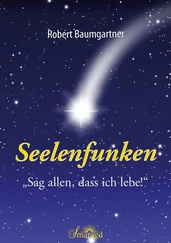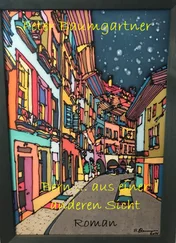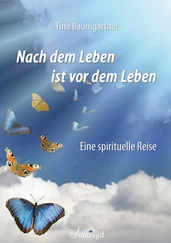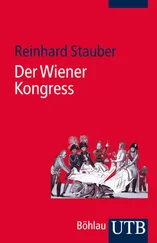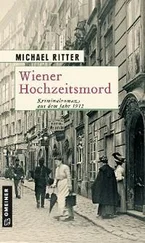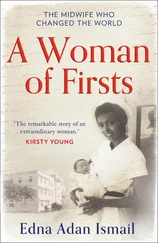Der Wiener hält Wien zwar für den Nabel der Welt, und eigentlich ist für ihn jeder ein Ausländer, der nicht aus Wien kommt. Aber der Wiener hat schon seinerzeit spätestens die Kinder von einem, der als Tscheche zugereist ist, als Wiener betrachtet. Wer ein Wiener sein will, ist für den Wiener ein Wiener. Deshalb hat einer, der in Wien versucht, Menschen ihrer Herkunft wegen gegeneinander auszuspielen, einen schweren Stand. Nicht das moderne Wien hat er gegen sich, im Gegenteil: Er rennt gegen den Wiener Geist an, gegen die Tradition Wiens als Hauptstadt des habsburgischen Vielvölkerstaates. Und nur ein Ang’rennter 16rennt in Wien gegen die Wiener Tradition an.
Wien tut alles, um die sozialen Zustände laufend zu verbessern. Sogar meine Generation spürt das deutlich. Zum Beispiel kann ich mich noch gut erinnern: Wie ich ein Kind war, da haben an der Tür oft die Hausierer geklingelt. Das sind alles arme Hunde gewesen. Reich geworden ist keiner von seinem Geschäft. Eine Viechsarbeit ist das obendrein gewesen. Sie müssen bedenken: Die meisten Häuser haben entweder keinen Aufzug gehabt oder einen, den nur die Hausbewohner aufsperren haben können. Die Hausierer haben Stiegen steigen müssen, hinauf und hinunter, samt dem schweren Zeug, das sie mit sich geführt haben, um es an der Tür anzubieten, und meistens hat man sie ihnen vor der Nase zugeschlagen, die Tür.
Meiner Großmutter hat einer ganz besonders leidgetan. Ein zartes Männlein ist das gewesen, klein und mager, mit einem eingefallenen Gesicht, einer spitzen Nase und einem Wust an weißen Haaren, auf denen ein viel zu kleiner Filzhut gesessen ist, eine Filzjacke hat er angehabt, so abgetragen wie der Hut, und noch dazu war ein Bein etwas lahm. Das Zniachtl 17hat Honig verkauft und Spitzwegerichsaft. Der Honig ist in dicke Gläser gefüllt gewesen und der Spitzwegerichsaft in dicke Glasflaschen. Das alles hat er in einem Rucksack transportiert und in zwei großen Taschen aus Leder, das schon ganz zerschlissen war. Sie können sich vorstellen, wie er geschleppt hat. Meine Großmutter hat ihm immer zwei Gläser Honig und zwei Flaschen Spitzwegerichsaft abgekauft. Ich glaube, sie hat das nur gemacht, weil sie ihm seine Last erleichtern hat wollen. Honig hat sie nämlich verabscheut, und auch ich habe nie Honig von ihr bekommen. Wahrscheinlich hat sie den Honig, den sie dem Zniachtl abgekauft hat, an irgendjemanden verschenkt. An den Spitzwegerichsaft kann ich mich aber erinnern, hellgelb und picksüß ist er gewesen. Ich habe ab und zu ein Glas davon bekommen, stark mit Wasser verdünnt. Meine Großmutter hat einmal in der Woche einen Teelöffel unverdünnt eingenommen. Das beuge dem Husten vor, hat sie gesagt.
Kaum hat meine Großmutter dem Hausierer die paar Schilling 18gegeben gehabt, die er für den Saft und den Honig verlangt hat, hat er gesagt: „Deaf i eana jetzt no wos vualesn? 19“ Meine Großmutter hat gewusst, was kommt. „Nadüalich 20“, hat sie, gutmütig wie sie gewesen ist, geantwortet. Der Hausierer hat eine Bibel aus dem Rucksack hervorgeholt, die ist völlig zerlesen gewesen, hat sie irgendwo aufgeschlagen, kurz nach vor und zurück geblättert, dann hat er gesagt: „Ah ja, da hamma scho was. 21“ Dann hat er ihr zwei, drei Verse aus der Bibel vorgelesen, von denen er gemeint hat, dass sie gerade jetzt passen. Meine Großmutter hat an Gott geglaubt, sie ist auch in die Kirche gegangen, aber sie ist nicht so religiös gewesen, dass sie in der Bibel gelesen hätte. Katholiken machen das sowieso nicht so häufig wie Protestanten. Das hängt mit der Tradition ihrer Glaubensrichtungen zusammen. Wenn der Hausierer aus der Bibel vorgelesen hat, hat ihm meine Großmutter ganz ruhig zugehört und am Schluss „vergelt’s Gott“ gesagt. Der Hausierer hat gestrahlt, und ich bin sicher, er hat nicht gestrahlt wegen des kleinen Geschäfts, das er mit meiner Großmutter gemacht hat, sondern weil er ihr aus der Bibel vorlesen hat dürfen.
Auch eine alte Frau ist öfter gekommen. Klein ist sie gewesen und gebeugt. Meine Großmutter hat im fünften Stock gewohnt. Wenn sie bei ihr geläutet hat, ist sie außer Atem gewesen, hat gehustet und gekeucht. Meine Großmutter hat sie immer hereingebeten und sie in der Küche ausruhen lassen. Sie hat ihr ein Glas Wasser gegeben und ein Stück Gugelhupf, wenn vom Sonntag noch einer dagewesen ist. Die Frau hat Büschel von getrocknetem Lavendel verkauft. Sie hat sich in Positur geworfen als hätte sie einen Auftritt in der Wiener Staatsoper. Dann hat sie, mit zittriger Stimme und kurzatmig vom Stiegensteigen, das alte Lied der Lavendelweiber gesungen: „Lavendel kaft’s, fümf Schülling zwaa Boschn Lavendel. Lavendel kaft’s! 22“ Das Lied hat sie sich nie nehmen lassen. Es ist für sie so eine Art Vorbedingung gewesen, um überhaupt ein Geschäft anbahnen zu dürfen, denn erst, nachdem sie das Lied gesungen hat, hat sie ihre Ware angeboten. Meine Großmutter hat ihr immer ein paar Büschel Lavendel abgekauft. Sie hat sie in die Wäschekästen gelegt. Alle Wäsche hat bei meiner Großmutter nach Lavendel gerochen. Heute noch glaube ich, denke ich an meine Großmutter, den Geruch von Lavendel in der Nase zu haben – oder den von Kölnischwasser, das ist meiner Großmutter das liebste Parfum gewesen.
Wenn wir uns so darüber unterhalten, merke ich, dass auf gewisse Weise auch meine Großmutter ein Original gewesen ist. Wir werden ihr sowieso noch einmal begegnen in Zusammenhang mit einem anderen Original, nämlich mit dem Bruno Kreisky.
Ja, schauen Sie, Original ist man oder ist man nicht. Es kommt nicht darauf an, ob einer berühmt ist, ob einer ganz hoch oben steht oder ganz tief unten. Abgesehen davon, wer sagt schon, was hoch oben und was tief unten ist? Ich kenne welche, die ganz hoch oben sind, aber für mich sind sie ganz tief unten, und ich kenne welche, die sind ganz tief unten, aber für mich sind sie ganz hoch oben. Es kommt nur darauf an, wie man es nimmt.
Jedenfalls sucht sich keiner aus, ein Original zu sein, nicht einmal in Wien. Man sagt nicht einfach: Ich werde ein Original, oder gar: Wenn ich schon sonst nichts erreicht habe, dann will ich wenigstens ein Original sein. Ich meine, es gibt schon Leute, die genau so handeln, nur sind die dann am Ende gar nichts, weder sind sie ein Original, noch sind sie sie selbst. Ein Original ist man, oder man entwickelt sich zu einem, ganz ohne eigenes Zutun. So ist das. Bei manch einem Original kennt man nicht einmal den Namen. Viele Marktfrauen waren Originale, zum Beispiel die Helga Barischitz. Die ist im Grund gar nichts Besonderes gewesen, und doch ist sie tief in meinem Gedächtnis mit ihrem rosigen Gesicht, der Haube und der Brille mit den runden Gläsern. Einen Fleisch- und Wurststand hat sie gehabt auf dem Brigittamarkt. Meine Großmutter und sie haben immer schmähgeführt. Einmal hat die Frau Barischitz gesagt, es sei vor einigen Jahren im Winter so kalt gewesen, dass ihr das Feuer im Kamin eingefroren ist. Hab’ ich Ihnen das schon einmal erzählt? Das ist der erste richtige Schmäh gewesen, den ich gehört habe. Die ist ein richtiges Original gewesen, die Frau Barischitz. Im ganzen Grätzel hat man sie gekannt und gemocht, weil sie es verstanden hat, jedem Menschen den Tag ein bisschen aufzuhellen, selbst wenn es schon ein wolkenloser Sommertag gewesen ist.
Apropos Original: Also die G’schicht’ mit der Tante Friedl und dem Oskar Piwonka – ich sage Ihnen …
Jetzt muss ich Ihnen was erzählen, und zwar über den Piwonka.
Dabei weiß ich gar nicht viel über den Oskar Piwonka, aber das bisserl, das ich weiß, ist es wert, einen Zuhörer zu finden. Ich selber hab’ es von der Friedl Dallabona erfahren, die ich immer nur Tante Friedl genannt habe, obwohl sie keine Verwandte gewesen ist, sondern die Freundin meiner Großmutter mütterlicherseits.
Aber bevor ich Ihnen was über den Piwonka erzähle, muss ich Ihnen was über die Gemeindebauten erzählen, sonst haben Sie nichts davon, von der Geschichte über den Piwonka, meine ich.
Читать дальше