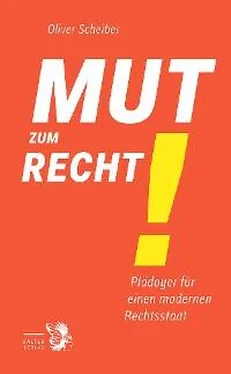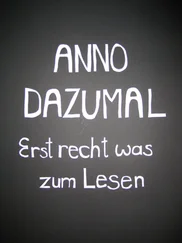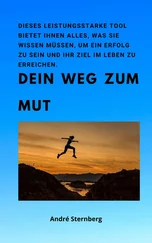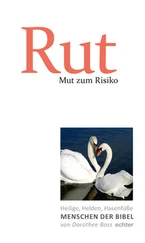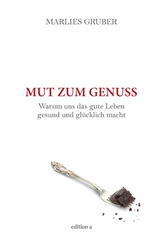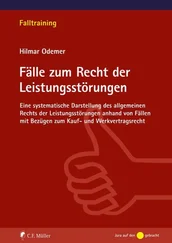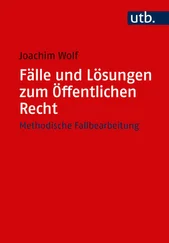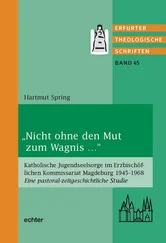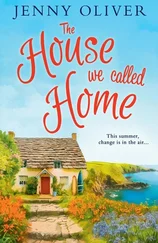Oliver Scheiber - Mut zum Recht!
Здесь есть возможность читать онлайн «Oliver Scheiber - Mut zum Recht!» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mut zum Recht!
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mut zum Recht!: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mut zum Recht!»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine Justiz, die ihren Anspruch nicht aufgeben darf, moderner, das heißt menschengerechter zu werden.
Mut zum Recht! — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mut zum Recht!», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
„Crainquebille“ zeigt eine Klassenjustiz, die völlig bedenkenlos im Sinne der Mächtigen agiert. Die Erzählung erschien, als die Dreyfus-Affäre auf ihren Höhepunkt zusteuerte, und ist zweifellos in deren Kontext zu sehen. Die Kritik am Justizsystem hat darüber hinaus aber allgemeine Gültigkeit, zeigt sie doch die Hilflosigkeit des einfachen, mittellosen und ungebildeten Menschen im Gerichtssaal, vor dessen Ritualen und der dort herrschenden abgehobenen Sprache. Interessant ist, dass Karl Kraus etwa zur selben Zeit seine Prozessbeobachtungen unter dem Titel „Sittlichkeit und Kriminalität“ veröffentlichte.
France’ Erzählung ist formal äußerst kompakt und kurzweilig. Die Sprache ist einfach, voll Ironie, Witz, Spott und Sarkasmus. Während der Autor mit diesen Mitteln Missstände anprangert, lässt er den einfachen, unter die Räder der Gesellschaft gekommenen Personen, wie hier dem Gemüsehändler Crainquebille, Wärme und Empathie zukommen. Der Autor ergreift die Partei der wirtschaftlich Schwachen, die unter den damaligen Verhältnissen kaum Möglichkeiten hatten, sich aus ihrem Elend zu befreien. Diese auch in den anderen Werken von France dominierende Grundhaltung machte ihn nach Émile Zolas Tod (1902) zur führenden Persönlichkeit unter jenen französischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die für eine gerechtere Gesellschaftsordnung ein- und gegen soziale Missstände auftraten.
Die Erzählung, der schon zitierte Schlusssatz der Urfassung macht es deutlich, enthält wenig Hoffnung. Der Romanist Thomas Baldischwieler bringt es im Nachwort der Reclam-Ausgabe auf den Punkt, wenn er davon spricht, dass die Geschichte um Crainquebille deprimierender als die Dreyfus-Affäre, trotz aller Anklänge an diese, sei, da Crainquebille nicht einmal begreife, dass er Opfer eines Justizirrtums geworden ist.
Crainquebille ist sich im Zuge seiner Auseinandersetzung mit dem Polizisten noch sicher, diesen nicht beleidigt zu haben. Beeindruckt von der Zeremonie der Verhandlung und der Ausstattung des Gerichtssaals, stellt sich bei ihm jedoch ein Schuldbewusstsein ein, das der Autor mit der Erbsünde vergleicht. Die Verurteilung wird für Crainquebille zu einem „hehren Mysterium“, zu einer „zugleich dunklen und einleuchtenden, herrlichen und schrecklichen Offenbarung“.
Der Justiz gelingt es, den unschuldigen Crainquebille allein schon mit ihrem Zeremoniell und ihren Ritualen zu erschlagen:
„Er war sich selbst nicht darüber klar, dass sich die Richter geirrt hatten. Das Gericht hatte seine geheimen Schwächen unter der Erhabenheit der Formen vor ihm verborgen. Er vermochte nicht zu glauben, dass er Recht haben sollte gegenüber Männern in der Robe, deren Rechtsgründe er nicht verstanden hatte: Unmöglich konnte er davon ausgehen, dass etwas an dieser schönen Zeremonie nicht in Ordnung sein mochte. Denn da er weder in die Messe ging noch im Élyséepalast verkehrte, hatte er im Leben noch nichts so Schönes gesehen wie diese Verhandlung vor der Strafkammer.“
Dieser kurze fünfte Abschnitt der Erzählung mit dem Titel „Von Crainquebilles Unterwerfung unter die Gesetze der Republik“ schließt an den ersten Abschnitt an, der nicht ohne Sarkasmus mit „Von der Erhabenheit der Gesetze“ bezeichnet wird. Hier, am Beginn der Erzählung, hebt der Autor das Einschüchternde an der Erscheinung von Gerichtssaal und Richtern hervor: die Verdienstorden, die der Richter in der Verhandlung trägt, die Büste der Republik und das Kreuz an der Rückwand des Verhandlungssaales. Crainquebille empfindet im Verhandlungssaal „den gehörigen Schrecken“, er ist, von Ehrerbietung durchdrungen, von Furcht und Schrecken überwältigt, bereit, die Entscheidung über seine Schuld ganz den Richtern anheimzustellen. Vor seinem Gewissen empfand er sich nicht als Verbrecher. Doch er spürte, wie wenig das Gewissen eines Gemüsehändlers im Angesicht der Symbole des Gesetzes und der Bevollmächtigten der rächenden Gesellschaft bedeutete: „In dieser Umgebung verschlossen ihm Ehrfurcht und Angst den Mund.“ In der Verfilmung der Erzählung wird die Übermacht des Gerichts mit – für die damalige Zeit beachtlichen – Trickeffekten versinnbildlicht, indem die Richter und der Polizeibeamte im Gerichtssaal zu Riesen werden.
Die Erzählung spricht die Ähnlichkeiten zwischen Gerichtsverhandlungen und religiösen Zeremonien an. Beides rituelle Handlungen innerhalb entsprechender Baulichkeiten, wirken sie erschreckend und Ehrfurcht einflößend. Betrachten wir heute einen der historischen Verhandlungssäle des Obersten Gerichtshofs im Justizpalast in Wien, so können wir Crainquebilles Gefühle gut nachempfinden. Prunkvoll ausgestattete Räume mit stark erhöhten Richterbänken, womöglich zusätzlichen Schranken, die die Angeklagten oder Parteien des Verfahrens vom Richtertisch noch weiter abtrennen, dunklem Holz sowie staatlichen oder religiösen Symbolen sind durchaus in der Lage, eine faire Kommunikation erst gar nicht aufkommen zu lassen. Nach heutigem Verständnis verlangt ein faires Verfahren im Sinne der Menschenrechtskonvention wohl auch eine adäquate Ausstattung des Verhandlungssaals.
In den letzten Jahren ist es durch eine nüchterne Gerichtsarchitektur zu einem gewissen Bruch mit der Vergangenheit gekommen. Gemeinsam mit diversen Änderungen der Prozessordnungen – Sitzgelegenheit für Angeklagte, Zeuginnen und Zeugen bei ihren Einvernahmen, Zurückdrängung der Beeidigung – führte dies zu einer neuen Kultur des Gerichtssaals, die modernen Vorstellungen von Justiz und Streitbeilegung angemessener ist. Fragt man Parteien und Zeuginnen sowie Zeugen, aber auch Geschworene und Schöffinnen und Schöffen nach ihren Eindrücken von Gerichtsverhandlungen, so hört man freilich nach wie vor viel zu oft, dass sie sich überfahren und in die Ecke gedrängt fühlten.
Die Autorität muss jedoch nicht ganz ohne Insignien auskommen. Der Talar, den der Richter oder die Richterin in der Verhandlung trägt, kann für alle Beteiligten positiv wirken. Für Angeklagte im Strafprozess bzw. Parteien des Zivilverfahrens, weil er deutlich macht, dass der Richter und die Richterin Träger der staatlichen Macht sind. Auch wenn es in der Verhandlung zu einem ruhigen Austausch der Argumente zwischen Gericht und Parteien kommt, wird am Ende doch der Richter bzw. die Richterin eine Entscheidung treffen, die für alle verbindlich ist. Diese Hierarchie des Gerichtssaals bleibt durch den Talar für alle ständig präsent. Auch für die Richterinnen und Richter: Tragen sie den Talar, so verstecken sie sich zwar nicht hinter dem Gesetz, es wird aber auch für sie selbst deutlich, dass sie eine Rolle spielen, nämlich die eines Wahrers und Anwenders der Gesetze. Entspricht ein anzuwendendes Gesetz nicht der persönlichen Einstellung des Justizorgans, was zwangsläufig immer wieder vorkommt, so wird die Erfüllung der Aufgabe einfacher, wenn der Talar dem Richter bzw. der Richterin die Rolle als Amtsträger bzw. Amtsträgerin ins Bewusstsein ruft. Im Übrigen unterliegt auch die Haltung zu den Insignien der Macht der Mode. Es gibt Generationen von Richterinnen und Richtern, die ziemlich geschlossen den Talar tragen, dann wieder andere, bei denen sich der Talar geringerer Beliebtheit erfreut. In den österreichischen Gerichtssälen tragen die Richterinnen und Richter in Strafverhandlungen in der Regel den Talar. Die Zivilrichterinnen und Zivilrichter, vornehmlich der älteren und mittleren Generation, verhandeln auch gerne in ziviler Kleidung – und nehmen damit in Kauf, das Gesetz zu verletzen, das das Anlegen des Amtskleids (eines schwarzen Talars und einer Kappe, Barett genannt) vorschreibt und auch – freilich rein männerbezogen – Details nicht vergisst: „Zum Amtskleid sind zu tragen: ein Straßenanzug oder ein Anzug aus dunklem Stoff, schwarze Straßenschuhe, dunkle Socken oder Strümpfe, eine Krawatte aus schwarzem Stoff und ein weißes Hemd“, heißt es in der Verordnung des Bundesministeriums für Justiz vom 9. Mai 1962.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mut zum Recht!»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mut zum Recht!» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mut zum Recht!» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.