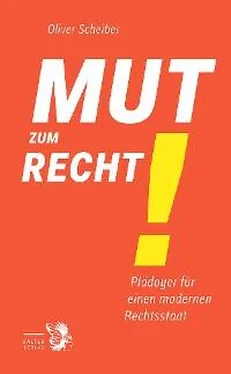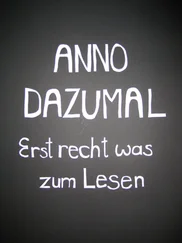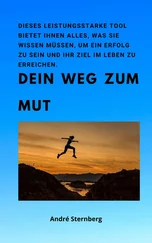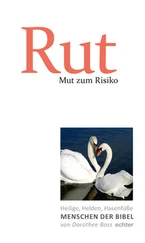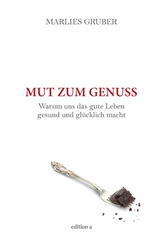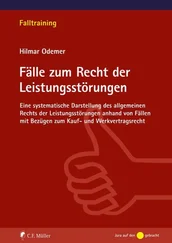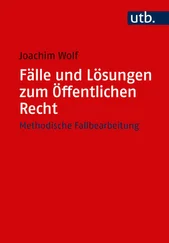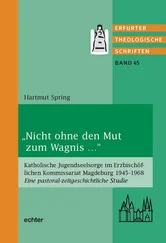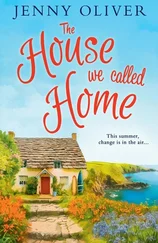Bereits 1975 war es bei der großen Strafrechtsreform in Österreich eines der vordringlichen Ziele, die kurzen Gefängnisstrafen durch andere Sanktionsformen wie Geldstrafen zurückzudrängen. Das ist damals gelungen, in den folgenden Jahrzehnten bis heute ist der Anteil der kurzen Gefängnisstrafen aber wiederum gleichgeblieben, trotz aller Versuche, diese Sanktionsform weiter zurückzudrängen. Noch immer sind zwei Drittel aller verhängten Gefängnisstrafen solche mit einer Dauer von unter sechs Monaten. Eine solche Zeit ist zu kurz, um während der Haft auf den Täter durch Therapien oder auf andere Weise resozialisierend einzuwirken, Arbeitsumgebung und private Beziehungen des Verurteilten werden aber nachhaltig und langfristig gestört. Der Gesetzgeber hat rund um das Jahr 2000 alternative Erledigungsformen eines Strafverfahrens geschaffen. So entfällt etwa das Urteil, wenn es in minderschweren Fällen zu einem Ausgleich zwischen Täter und Opfer kommt oder wenn der Beschuldigte gemeinnützige Arbeiten leistet. Dies war ein Schritt, kurze Gefängnisstrafen zurückzudrängen und andere, konstruktivere Sanktionsformen zu fördern.
„Seine Unbeweglichkeit hatte etwas Übermenschliches; das Spiegelbild seiner Stiefel auf dem nassen Bürgersteig, der wie ein See aussah, verlängerte ihn nach unten und ließ ihn von Ferne wie ein amphibisches Ungeheuer erscheinen, das halb aus dem Wasser ragte. Aus der Nähe hatte er mit seinem Kapuzenmantel und seiner Waffe zugleich etwas Mönchisches und etwas Soldatisches. Seine derben Gesichtszüge, die durch den Schatten der Kapuze noch vergröbert wurden, nahmen sich friedlich und traurig aus.“
Anatole France beschreibt mit dieser Schlusssequenz in „Crainquebille“ wohl das Frankreich während der Dreyfus-Affäre, wie er es erlebt hat: kraftlos, unbarmherzig, gleichzeitig traurig und schicksalhaft verwoben mit religiösen und soldatischen Kräften. France wurde sowohl von seiner Zeit als auch von der Nachwelt sehr oft als „mitfühlender Humanist“ beschrieben und geachtet. Mit seiner Erzählung „Crainquebille“ wird er zum Vorbild nicht nur für Kunstschaffende, sondern gerade auch für Juristinnen und Juristen.
Wie steht es um die Verbindung von Kunst und Justiz in der Gegenwart? Sie soll über die bloße Organisation von Ausstellungen in Gerichtsgebäuden hinausgehen, denn die Wirkungskraft der Kunst ist enorm. Während meiner Tätigkeit im Büro der früheren Justizministerin Maria Berger (2007–2008) gelang es, den bekannten charismatischen brasilianischen Theaterpädagogen Augusto Boal zu einem öffentlichen Vortrag nach Wien einzuladen. Mehr als 400 Besucher und Besucherinnen kamen am 8. April 2008 in die Aula des Wiener Justizpalastes. Am Tag zuvor leitete Boal ein Seminar für Richterinnen und Richter. Knapp zehn Jahre später betraute mich der damalige Ressortchef Wolfgang Brandstetter mit der Ausrichtung eines Justizsalons im Justizministerium. Im Mai 2017 las Ilija Trojanow im Großen Festsaal des Ministeriums aus seinem Band „Nach der Flucht“ und sprach mit der NZZ- Korrespondentin Meret Baumann über das Buch.
Als Leiter des Meidlinger Bezirksgerichts habe ich seit 2009 verschiedene Formate erprobt: etwa die Österreich-Premiere des Dokumentarfilms „Der Einzelkämpfer – Richter Heinz Düx“ von Wilhelm Rösing am Bezirksgericht Meidling. Heinz Düx hatte in den 1960er-Jahren als Untersuchungsrichter die deutschen Auschwitzverfahren vorbereitet und ermöglicht. Im Jahr 2012 kam Düx, bereits an die neunzig Jahre alt, nach Wien und sprach bei zwei Veranstaltungen vor mehr als 300 Personen. Etwa zur selben Zeit konnte ich mit dem Max Reinhardt Seminar ein eigens für das Bezirksgericht entwickeltes Theaterprojekt verwirklichen. Eine vom damaligen Regiestudenten Josua Rösing entwickelte dramatische Fassung von Kafkas „Die Verwandlung“ gelangte am Bezirksgericht mehrmals zur Aufführung. Der Publikumszulauf war beachtlich. Die Auftretenden Johanna Wolff, Konstantin Shklyar und Tino Hillebrand sind mittlerweile an großen Bühnen tätig. Hillebrand ist Ensemblemitglied des Burgtheaters, Regisseur Josua Rösing inszeniert derzeit in Berlin, Kiel, Regensburg und St. Petersburg. Das von Mira König gestaltete Bühnenbild wurde ein Jahr lang im größten Verhandlungssaal des Bezirksgerichts Meidling als temporäres Kunstprojekt erhalten. Jahre nach dem Kafka-Projekt konnte ich Josua Rösing für das erste gemeinsame Seminar für Verwaltungs-, Zivil- und Strafrichter gewinnen; im Herbst 2017 gestaltete er gemeinsam mit der Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger einen Workshop zum Thema der Wahrheitsfeststellung. Dabei zeigte sich die Wirksamkeit künstlerischer und interdisziplinärer Zugänge.
Am Bezirksgericht Meidling finden nun seit zehn Jahren mehrmals jährlich öffentliche Veranstaltungen statt. Ein Abend über Europa mit Reden des mittlerweile verstorbenen großen Publizisten Ari Rath und der Schriftstellerin Jagoda Marinić im Mai 2016 stieß ebenso auf großes Interesse wie eine Werkschau des Malers Josef Schützenhöfer 2015/2016 und eine Ausstellung über Falco im Jahr 2018. Die Öffnung der Gerichtsräumlichkeiten trägt dem Gedanken Rechnung, dass Amtsgebäude der Öffentlichkeit gehören und Orte des Austauschs und der Diskussion sein sollen.
Für die Grundausbildung der Richterinnen und Richter arbeite ich seit Jahren mit dem Schauspieler und Regisseur Nikolaus Habjan zusammen. Sein mit dem Nestroy-Preis ausgezeichnetes Stück „F. Zawrel – erbbiologisch und sozial minderwertig“ über die NS-Verbrechen am Spiegelgrund und ihre gescheiterte Aufarbeitung ist in Ausbildungsmodule der Justiz integriert und ein wichtiges didaktisches Element der Richterausbildung. Die Evaluierung der Aus- und Fortbildung zeigt, dass künstlerische Beteiligung und Intervention nicht nur gern gesehen ist, sondern auch sehr nachhaltig wirkt und Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Reflexion der richterlichen Tätigkeit unterstützt.
THESE 1 
DIE KUNST LIEFERT DER JUSTIZ WICHTIGE IMPULSE
Die Kunst beschäftigt sich seit jeher mit den zentralen Fragen des Lebens. Viele Künstlerinnen und Künstler bearbeiten außerdem aktuelle Geschehnisse und Trends der Zeit. Die Justiz, die täglich ins Leben vieler Menschen eingreift und mit den Nöten der Menschen laufend konfrontiert ist, profitiert von einem Austausch mit der Kunst. Die Kunst spendet Anregungen und liefert vielfach eine Kritik, die sonst im Berufsalltag gegenüber Justizorganen nicht geäußert wird.
Die Justiz sollte die Vernetzung mit der Kunst als Tool für die Aus- und Fortbildung noch stärker nutzen. Die Kunst kann ein zentrales Element bei der Auseinandersetzung mit der richterlichen Tätigkeit sein. Je präsenter die Kunst in Gerichtsgebäuden und in der Aus- und Fortbildung der Richter*innen und Staatsanwält*innen ist, umso nachdenklicher und den Menschen zugewandter ist die Justiz. Als Beispiel dient Nikolaus Habjans Inszenierung „F. Zawrel“, die seit einigen Jahren in der Grundausbildung der Justiz eingesetzt wird. Die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern und Kunststätten liefert der Justiz Impulse und erweitert den Horizont der Einzelnen und des Systems.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.