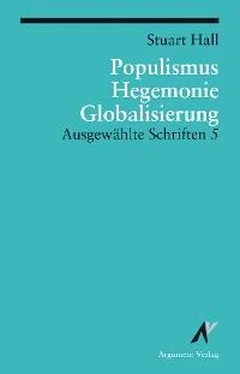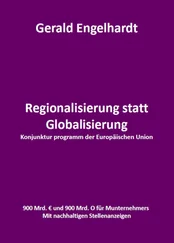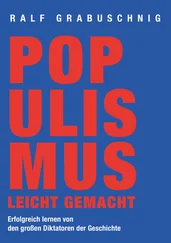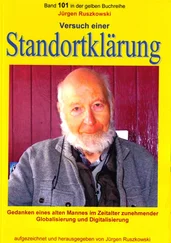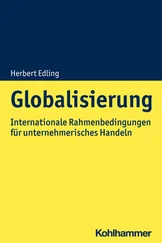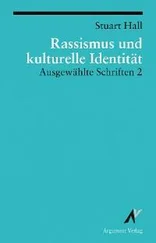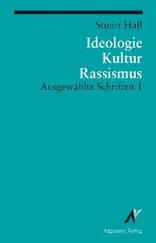Hamburg, Tampere und Wien, November 2013
Die Herausgeber
Der Staat ist eine historische Erscheinung: er ist ein Produkt gesellschaftlicher Vereinigung – von Frauen und Männern, die in organisierter Weise zusammenleben; der Staat ist kein natürliches Produkt. Es gab Zeiten, in denen ›der Staat‹ – so wie wir ihn kennen – nicht existierte. Clans und Sippschaften der Frühgeschichte, semi-nomadische Völker oder sesshafte Stämme mit sehr einfachen Formen sozialer Organisation, sie alle bildeten das heraus, was wir heute Gesellschaft nennen – ohne einen Staat zu besitzen. Hieraus muss noch lange nicht geschlussfolgert werden, dass sie führerlos sind oder dass es ihnen an geregelten Verfahren der Auseinandersetzung mangelt. Ordnung und soziale Kontrolle lassen sich durch viele andere Mittel und Möglichkeiten aufrechterhalten als durch eine zentralisierte Autorität oder einen Regierungsapparat. Gewohnheit und Brauch können die gleiche zwingende Macht über menschliches Verhalten erlangen wie das kodifizierte Recht. In einigen staatenlosen Gesellschaften nimmt der Vorstand des Haushaltes oder nehmen Anführer von Abstammungsgruppen die Funktion von Regelungsverfahren ein, ohne die Grundlage einer dauerhaften Herrschaftsordnung herauszubilden.
Diesen Kontrast mit ›staatenlosen Gesellschaften‹ zu bilden hilft uns festzulegen, was der Staat ist. Simon Roberts (1981) definiert den Staat folgendermaßen: »eine höchste Autorität […], die über ein bestimmtes Territorium herrscht; die anerkanntermaßen die Macht hat, Entscheide zu fällen, die ihre Herrschaft betreffen […], die ferner in der Lage ist, ihre Entscheide durchzusetzen und überhaupt die Ordnung im Staate aufrechtzuerhalten.« Demnach ist die Fähigkeit zum Ausüben von Zwangsgewalt ein entscheidendes Element: »Die elementarste Prüfung der Autorität eines Herrschers entscheidet sich mit der Frage, ob er Gewalt hat über Leben und Tod seiner Untergebenen.« (145f.) Dies definiert Staatsgewalt als einen rechtmäßigen Anspruch des Staates auf Gehorsam seiner Untertanen. Alle Staaten hängen von diesem besonderen Verhältnis zwischen Herrschaft und Unterwerfung ab. Herrschaft wird als die Macht verstanden, Entscheidungen über die ›grundsätzlichen Regeln‹ für die ganze Gruppe zu treffen. Zu prüfen ist, innerhalb welcher Grenzen und mittels welcher Personen der Staat seinen Rechtswillen durchsetzen kann. Innerhalb dieser Grenzen ist der Staat die höchste Autorität.
Früh-Geschichten des modernen Staates
Der Staat ist in einem weiteren Sinne historisch: er verändert sich im Laufe der Zeit und im Verhältnis zu spezifischen Bedingungen und Umständen. Seit der Antike existierte in Westeuropa eine organisierte öffentliche Gewalt, die Autorität beanspruchte und kontinuierlich als legitime Herrschaft agierte; obwohl der heutige Begriff ›Staat‹ lange Zeit mit seiner üblichen modernen Bedeutung gar nicht gebraucht wurde.
Aus den Clans und Stämmen der frühen griechischen Zivilisation heraus erschien eine überraschend ›fortschrittliche‹ Form des Staates – der Stadt-Staat oder die polis. Dies gab uns die Saat für zwei mächtige Begriffe, die mit dem modernen Staat verbunden sind: ›Demokratie‹ von demos, die Herrschaft des Volkes oder der Bürgerschaft; und polis, die Wurzel der Wörter wie z. B. ›politisch‹ oder ›Politik‹. Das antike Griechenland stellte auch zwei wesentliche Überlegungen zu Regierung und Herrschaft bereit, die weitgehend als Gründungstexte der politischen Philosophie in Europa angesehen werden: Platons Der Staat und Aristoteles’ Politik.
Die Periode der hellenischen Stadt-Staaten dauerte ungefähr von 800 bis 500 vor Christus. Die frühen ›Tyrannen‹ brachen die Macht des Landadels über die Regierung der Städte, und nahezu die ganze Bürgerschaft, einschließlich der Klein- und mittelgroßen Bauern, erhielt Rechte. In der polis gehörten alle Bürger der Volksversammlung an, konnten wählen und direkt an der Regierung partizipieren: eine ›direkte Demokratie‹, manchmal bis zu 5000 – 6000 Bürger umfassend, mit einer wenig eingreifenden Verwaltung oder Bürokratie. Allerdings hatte die große Zahl der Sklaven, die die Basis der athenischen Demokratie ausmachten, weder Rechte noch den Status eines Staatsbürgers.
Später wurden die Stadt-Staaten durch das athenische und andere Imperien absorbiert, die in der Folge von territorialer Eroberung expandierten. Diese Expansion stellte die griechische Demokratie ernsthaft auf den Prüfstand. Es erwies sich als schwierig, das ortsgebundene Konzept von Bürgerschaft auf die anderen 150 Städte auszudehnen, die das athenische Imperium verschlang. Nach Alexander dem Großen wurde die Herrschaft eines alleinigen Machthabers mit einer königlichen Thronfolge eingeführt. Der königliche Regent wurde mit einem göttlichen Status gekrönt und seine eigene Person zu einem ›Gott‹ erhöht.
Auch Rom entstand aus einem mächtigen Stadt-Staat. Anders als sein griechisches Gegenstück wurde Rom nie ›demokratisiert‹. Die Römische Republik (vom lateinischen res publica; ›die zur öffentlichen Sphäre gehörenden Dinge‹: ein Begriff, der oft gebraucht wird, um das zu bezeichnen, was wir heute ›den Staat‹ nennen) basierte auf einem Senat, der von aristokratischen Mächten dominiert wurde. Später wurde seine Basis erweitert: durch Volksversammlungen gewählte Konsuln wurden eingebunden. Römische Bürgerschaft wurde eher durch das Recht bestimmt und weniger durch strikte Territorialität. Weil es keine ›direkte Demokratie‹ war, war es einfacher, die römische Bürgerschaft um die herrschenden Klassen anderer Städte und Territorien zu erweitern, die von den Römern erobert wurden. ›Civis Romanus sum‹: ein römischer Bürger war ein Staatsbürger, der irgendwo und überall war.
Die soziale Basis der römischen Zivilisation war die grundbesitzende Klasse; das Land wurde von einer abhängigen und verschuldeten Bauernschaft bearbeitet, später ergänzt durch Sklavenarbeit. Die ländliche Gegend wurde zunehmend von Kleinbauern besiedelt, frei im Status, aber ›besitzlos‹. Die Unterklasse der Städte waren die ›proletarii‹ (Herkunft des Begriffs ›Proletariat‹). Das Ausmaß der Land-Transaktionen, der Handelsregulierung und der Vererbung von Privateigentum, die Definition von Staatsbürgerschaft und die Herausbildung von Unterschieden zwischen der öffentlichen Rolle der Grundeigentümer als Bürger und ihrer ›privaten‹ Rolle als Vorstand der Familienhaushalte – pater familias – führten zu einem weiteren wichtigen Beitrag Roms zum europäischen Staat: ein systematisierter Kodex des ›Römischen Rechts‹. Römisches Recht half die Unterscheidung zwischen ›Staat‹ und ›Gesellschaft‹ zu begründen, oder zwischen dem Öffentlichen (dem Staat und öffentlichen Angelegenheiten zugehörig) und dem Privaten (den Beziehungen privater Vereinigungen, der ›Zivilgesellschaft‹ und dem häuslichen Leben der patriarchalen Familie zugehörig).
Innere Spannungen entstanden aufgrund der ungleichen Verteilung von Land, der Forderungen der ›Landlosen‹ und der Sklavenaufstände, auch aufgrund der Probleme, die weit zerstreuten, von der römischen Armee eroberten Provinzen innerhalb eines vereinten Staates besetzt zu halten, sowie der Herausforderungen an die senatorische Macht – all dies trieb Rom zu einer zentralistischeren Herrschaftsform. Unter Augustus bildete sich das römische Kaisertum als neues System heraus. Trotzdem lehnte sich der römische Staat noch an ein System des Bürgerlichen Rechts an, und es wurde weiterhin erwogen, die Gesetze in unbestimmter Weise vom ›Volk‹ herzuleiten – aber nicht im Sinne eines souveränen ›Volkswillens‹, wie wir ihn aus heutigen modernen Demokratien kennen.
Dieser Ansatz, dass Staatsmacht sich aus dem Recht ableitet, war entscheidend für die nachfolgende Entwicklung des ›Rechtsstaatsprinzips‹ und des ›Verfassungsstaates‹. In der Ära der Republik formulierte Cicero die Grundlinie des senatorischen Regimes wie folgt: »Wir gehorchen den Gesetzen, um frei zu sein.« Im spätrömischen Imperium, als die Kaiser volle despotische Herrschaft ausübten und göttlichen Status einnahmen, erfolgte eine signifikante Verschiebung, die im 3. Jahrhundert von dem Philosophen Ulpian formuliert wurde: »Der Wille des Herrschers hat Gesetzeskraft.« Dennoch sollte das Recht weiterhin ein wichtiges Ideal der Herrschaft und des Staates darstellen.
Читать дальше