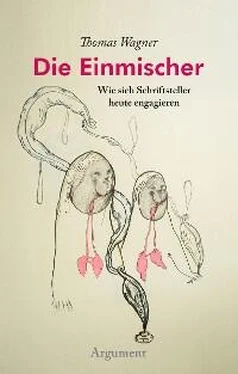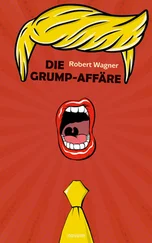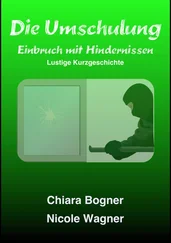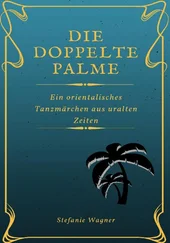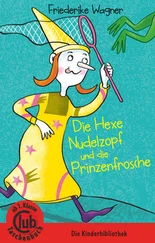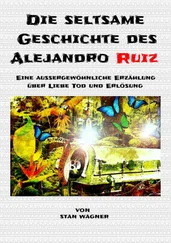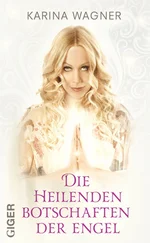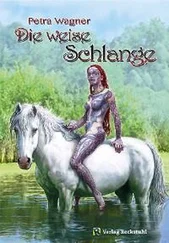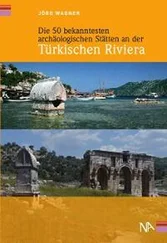Als Ende 2008 Erasmus SchöfersRoman Winterdämmerung erschien, wollte in Deutschland zunächst kaum jemand Notiz davon nehmen. Nach wie vor gehört Schöfer zu den großen Unbekannten unter den Romanciers seines Landes. Die ersten Rezensionen erschienen in kleinen linken Zeitungen. Dabei handelt es sich beim abschließenden Teil des vierbändigen Romanzyklus Die Kinder des Sisyfos um ein bedeutendes Stück engagierter Literatur. Erfolgreiche jüngere Autoren wie Ilija Trojanow und Dietmar Dath sind begeisterte Leser der Tetralogie. Von einer Fortsetzung der Ästhetik des Widerstands (Peter Weiss) ist zuweilen die Rede. Das 2000 Seiten starke Epos erzählt die Geschichte der westdeutschen Linken von 1968 bis 1990 entlang ausgewählter Stationen und fiktiver Biografien. Dabei versucht er die Motive der aufbrechenden Menschen, ihre Impulse und moralische Empörung so festzuhalten, wie sie damals von ihnen empfunden wurden. Ein Reporter, ein Historiker, eine Schauspielerin und ein Werkzeugmacher sind die Hauptfiguren. Im Mittelpunkt von Winterdämmerung stehen die Massenproteste der Friedensbewegung gegen die atomare Aufrüstung, der Kampf für die 35-Stunden-Woche und der Widerstand gegen die Schließung der Rheinhausener Stahlhütte. Die realistische Darstellung der Arbeitswelt seiner Akteure ist Schöfer dabei ebenso wichtig wie die lebendige Schilderung ihrer politischen Auseinandersetzungen, ihrer erotischen Begegnungen und Freundschaften. Seinen Stoff hat Schöfer als Journalist, Künstler und als politischer Aktivist selbst mitgeformt. Seine Szenerien sind authentisch, die Diskussionen realitätsnah, die Konflikte glaubwürdig geschildert. Obwohl Schöfers Figuren scheitern, gelingt es ihnen, den utopischen Funken immer wieder neu zu entfachen, sich gegenseitig aufzurichten. Als der Staatssozialismus zusammenbricht, entdeckt der marxistische Historiker Bliss gemeinsam mit seiner Enkelin in der anarchistischen Kommune Kaufungen den realutopischen Vorschein einer solidarischen Gemeinschaftsform.
Neben anspruchsvollen politischen Romanen erlebt auch die Gattung der politischen Kampfschrift eine bemerkenswerte Renaissance. Neuere Texte von Dietmar Dath, Robert Menasse oder Raul Zelik zeigen eindrucksvoll, dass momentan inmitten der deutschsprachigen Literatur eine regelrechte Ideenwerkstatt für konkrete Utopien entsteht: sprachlich überzeugend, sachkundig und politisch vorwärtsweisend.
Den Anfang machten im Jahr 2006 Robert MenassesFrankfurter Poetikvorlesungen: Die Zerstörung der Welt als Wille und Vorstellung , eine fulminante Kampfansage an die neoliberale Ideologie und den Demokratieabbau im europäischen Einigungsprozess.31 Dem konformistischen Mainstream-Journalismus unserer Tage wirft Menasse ein Versagen auf der ganzen Linie vor, da er nicht zu analysieren vermöge, dass staatliche Sozialkürzungen nur deshalb notwendig erscheinen, weil das Kapital seinen Anteil am Gemeinwohl nicht mehr leisten wolle. Wo Konzerne von Steuern befreit, Sozialleistungen eingespart, Arbeitsdienste eingeführt, Freiheitsrechte eingeschränkt, durch das Feindbild islamischer Terrorismus gesellschaftliche Solidarität gestiftet, demokratische Errungenschaften der Nationalstaaten im Europa des Lissaboner Vertrags abgebaut und Rüstungsmaßnahmen legitimiert werden, erkennt Menasse eine Tendenz des neoliberalen Kapitalismus, die westlichen Gesellschaften auf eine neue Weise zu faschisieren. Mit dem Rückbau des Sozialstaats und der bürgerlichen Freiheiten sieht er heute Bedingungen kapitalistischer Herrschaft wiederhergestellt, für die Hitler lediglich die Antwort der dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts gewesen sei. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sieht Menasse alle zuvor bekannten Widersprüche des Westens in der totalitären Idee von »unserer Zivilisation« verschwinden, »die mit aller Gewalt verteidigt werden müsse«. Die Literatur habe dagegen die Aufgabe, sich für »die Befreiung von der Diktatur eines befreiten Kapitals« einzusetzen.
Juli Zehund Ilija Trojanowgelang 2009 mit Angriff auf die Freiheit eine scharfe Polemik gegen den Abbau der Bürgerrechte im Zeichen des internationalen Antiterrorkampfes. Das Buch kletterte alsbald auf die vorderen Ränge der Spiegel -Bestsellerliste. Für das Autorengespann ist die einzige Gefahr, die vom Terrorismus ausgeht, die Art, wie unsere Gesellschaft auf ihn reagiert. In ihrem Buch beschreiben sie, wie sich demokratisch verfasste Gesellschaften seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beinahe widerstandslos von ihren Regierungen in immer lückenloser überwachte Kontrollgesellschaften haben umbauen lassen. Rasterfahndung, biometrischer Reisepass, Telefonüberwachung und Online-Durchsuchung sind dafür einige der wichtigsten Stichworte. Sie zeigen, wie die NATO nach dem Ende des Kalten Krieges ihr Feindbild auf amorphe, prinzipiell nicht fassbare Gegner umstellte. Dabei handle es sich nicht nur um »terroristische Netzwerke«, sondern auch um Einwanderer, Flüchtlinge, ölfördernde Eliten sowie hungrige junge Männer, die sich nach Ansicht der westlichen Strategen nicht mehr im Griff haben und aufständisch werden.
Knapp, aber fundiert kritisieren Trojanow und Zeh den Gebrauch politischer Sprache. Sie zeigen, wie von interessierter politischer Seite systematisch Angst erzeugt wird, um die Akzeptanz von immer neuen Gesetzesverschärfungen und Repressionen vorzubereiten. Ausdrücke wie »Terrorverdächtiger«, »Gefährder«, »islamistische Zelle«, »radikaler Islamismus« geben nicht die Realität wieder, sondern sind politische Behauptungen von ideologischer Durchschlagskraft. So hat die Verwendung des Begriffs »Terrorverdächtiger« seit den Anschlägen auf das New Yorker World Trade Center ungeheuer zugenommen.
Der Schutz vor willkürlicher Verhaftung ist nach diesem Datum in den USA praktisch widerstandslos aufgegeben worden. Aus Grundrechten wurden Sicherheitslücken. Am Beispiel einer britischen Umweltorganisation zeigen die Autoren, wie die von den Regierungen und Medien benutzten Mechanismen der Angstmacherei schon heute mühelos vom Bereich des sogenannten radikalen Islamismus auf friedliche Protestbewegungen übertragen werden. So werden Öko-Aktivisten als Terroristen eingestuft und Globalisierungskritiker in Terror-Datenbanken gelistet. In Deutschland geriet ein Stadtsoziologe unter Terrorverdacht, weil sich auch von ihm benutzte Fachbegriffe in den Schreiben einer mutmaßlich militanten Gruppe wiederfanden. In Großbritannien werden heute selbst Ordnungswidrigkeiten mit Hilfe von Ausnahmegesetzen verfolgt. Angriff auf die Freiheit ist ein politischer Gebrauchstext von schlichter Schönheit, ein Aufruf zur Verteidigung der Bürgerrechte.
Seit Dietmar Dathseine sozialistische Streitschrift Maschinenwinter (2008) veröffentlicht hat, begeistern sich gerade junge Leser für das schmale Buch. Der Schriftsteller, Übersetzer und Journalist ist womöglich der derzeit meistzitierte deutschsprachige Gegenwartsautor im hiesigen Blätterwald. Dabei nimmt der überzeugte Marxist kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Kritik des Kapitalismus in der Perspektive seiner Überwindung geht. Neben einer kaum noch überschaubaren Anzahl ambitionierter Science-Fiction-Romane hat der Suhrkamp-Autor eine Reihe von Sachbüchern über Mathematik oder Phänomene der Popkultur geschrieben. Mit Maschinenwinter gelang ihm eine politische Kampfschrift, die bei alten und jungen Linken viel Zuspruch fand. Schon jetzt ist sie ein wichtiger Bezugspunkt für Debatten quer durch alle Fraktionen der Linken. Dath klärt auf, wie unvernünftig eine Welt organisiert ist, die angesichts hochentwickelter Produktivkräfte nicht in der Lage ist, den kollektiv geschaffenen Reichtum gerecht zu verteilen. Der Sozialismus verlangt in seinen Augen keineswegs einen neuen Menschen. Vielmehr sieht Dath schon die heute lebenden Vertreter der Gattung als hinreichend vernunftbegabt und lernfähig an, um der Herrschaft des Kapitals selbst ein Ende zu setzen.
Читать дальше