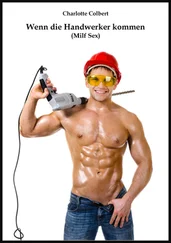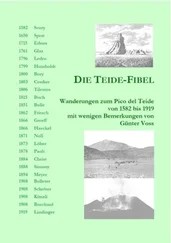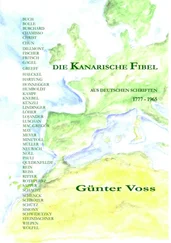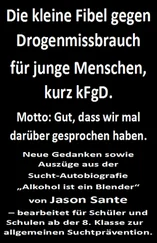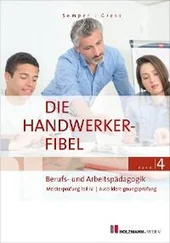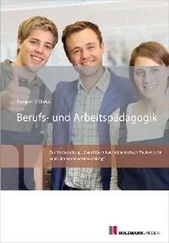Die Kosten- und Erlösrechnung (KER) bildet die Entstehung bzw. den Verzehr von Werten in einem Unternehmen zahlenmäßig ab. Kosten sind dementsprechend definiert als bewerteter, sachzielbezogener Güterverzehr und Erlöse als bewertete, sachzielbezogene Leistung einer Abrechnungsperiode. Die Informationen aus der Kosten- und Erlösrechnung können insbesondere für Zwecke der kurzfristigen Planung in Unternehmen genutzt werden.
Dokumentationsfunktion
Aufgabe der KER ist es unter anderem, realisierte Kosten zu ermitteln und zukünftige Kosten zu prognostizieren. Insofern kommt der KER eine Darstellungs- oder Dokumentationsfunktion zu.
Planungsfunktion
Auf Basis dieser Erkenntnisse können Entscheidungen über das Produktionsprogramm, Losgrößen und Bestellmengen getroffen werden. Auch für die Preispolitik und die Abgabe von Angeboten liefert die Kostenrechnung wichtige Informationen.
Steuerungsfunktion
Eine weitere Zwecksetzung der KER bezieht sich auf die Verhaltensbeeinflussung der Mitarbeiter. Durch die Vorgabe individueller Zielgrößen sowie die Verknüpfung von Belohnungen mit der Erreichung der Ziele können die Mitarbeiter motiviert werden, sich im Sinne der Unternehmensziele zu verhalten.
Kontrollfunktion
Außerdem liefert die KER Informationen, welche eine Wirtschaftlichkeitskontrolle des ganzen Unternehmens, einzelner Abteilungen oder Prozesse mittels Soll-Ist-Vergleich, Zeitvergleich oder Betriebsvergleich ermöglichen. Diese Kontrolle schließt auch die Ermittlung der Abweichungsursache mit ein, sodass daraus Schlüsse für zukünftige Entscheidungen gezogen werden können.
Schnittstelle zur Bilanzrechnung
In der Bilanz ist der Wert fertiger und unfertiger Erzeugnisse (hierzu zählen auch Baustellen) auszuweisen. Die KER stellt Informationen zur Verfügung, welche diese Wertermittlung ermöglichen. Umgekehrt stammen viele Quelldaten der KER aus der Bilanzrechnung.
Datenquelle
Eine weitere wesentliche Datenbasis für die KER stellen manchmal sogenannte ERP-Systeme (Enterprise Ressource Planing) zur Verfügung. Diese Systeme zur Unternehmensressourcenplanung erfassen sämtliche Abläufe in einem Unternehmen und stellen für die KER unter anderem Arbeitspläne und Stücklisten zur Verfügung. Vielfach werden auch Daten aus externen Quellen (z. B. ortsübliche Vergleichsmieten) sowie eigene Berechnungen (z. B. kalkulatorische Kosten) genutzt.
Zweige der KER
Die Aufbereitung und Verarbeitung dieser Quelldaten erfolgt nach vorher festgelegten Kriterien der Kostenzuordnung und -aufteilung. Diese erfolgt in drei Stufen: Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. Diese drei Rechnungen sind damit wesentliche Bestandteile der KER, gemeinsam mit der (kurzfristigen) Erfolgsrechnung.
Ebenfalls zum internen Rechnungswesen zählt die Finanzrechnung. Sie ist, wie der Name schon sagt, auf das Finanzziel des Unternehmens ausgerichtet. Primäre Aufgabe ist es folglich, durch den Erhalt der Zahlungsfähigkeit den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.
Im Rahmen der Finanzrechnung werden Informationen über die Liquidität eines Unternehmens bereitgestellt. Sie können einerseits vergangenheitsbezogen sein und sich auf bestimmte Bilanzrelationen beziehen. Auf der anderen Seite, und dies ist ihr eigentlicher Kern, basiert die Finanzrechnung auf der Prognose zukünftiger Zahlungsströme. Zahlungen sind dabei diejenigen Geschäftsvorfälle, die entweder den Bestand an liquiden Mitteln (Kasse) oder denjenigen des Geldvermögens (Bankguthaben) verändern. Wird dieser Bestand erhöht, spricht man von Einzahlungen und im umgekehrten Fall von Auszahlungen.
Zwecke der Finanzrechnung
Zur Erfüllung des Liquiditätsziels stellt die Finanzrechnung Informationen über Zahlungen, den Kapitalbedarf, die Kapitaldeckung sowie die Innenfinanzierungskraft (also die Fähigkeit eines Unternehmens, neue Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln zu finanzieren) eines Unternehmens bereit. Auf Basis dieser Erkenntnisse können rechtzeitig Maßnahmen zur Sicherung der Zahlungsbereitschaft bzw. zur rentablen Anlage von Einnahmeüberschüssen ergriffen werden. Im letzten Punkt kommt die zweite Zwecksetzung der Finanzrechnung zum Ausdruck, die besagt, dass durch eine optimale Investitions- sowie Kapitalstrukturpolitik der Gewinn bzw. das Vermögen eines Unternehmens gesteigert werden soll.
Zweige der Finanzrechnung
Je nach Datenbasis und Fristigkeit kann man vier verschiedene Formen der Finanzrechnung unterscheiden.
Finanzierungs- und Liquiditätskennzahlen
Die einfachste Form der Finanzrechnung ist die Bestimmung von Bilanzkennzahlen zur Finanzierung und zur Liquiditätsstruktur. Weil diese Kennzahlen auf Vergangenheitsdaten beruhen, ist ihre Vorhersagekraft in Bezug auf die zukünftige Zahlungsfähigkeit nur begrenzt. Weil es sich aber um ein einfaches und schnelles Verfahren handelt, erfreut sich diese Form der Finanzrechnung gerade in kleinen Unternehmen größter Beliebtheit. Die Kennzahlen berechnen in der Regel Deckungsgrade von verschiedenen Bilanzpositionen (>> Abschnitt 4.4.1).
|
Kennzahlen |
Liquiditäts-status |
Finanz-planung |
Kapitalbedarfs-planung |
| Aussage |
Deckungsgrade, Liquidität |
taggenaue Prognose der Zahlungsfähigkeit |
monatsgenaue Prognose der Zahlungsfähigkeit |
Deckungsgrad liquidierbares Vermögen ./. kurzfr. Kapital |
| Zeitbezug |
Analyse der Vergangenheit |
Zukunftsplanung – Monat |
Zukunftsplanung – Jahr |
Zukunftsplanung – mehrere Jahre |
| Datenquelle |
Bilanz |
Buchhaltung |
Produktions- und Absatzplan |
Plan-Bilanz, Plan-GuV |
Übersteigen die finanziellen Mittel beispielsweise die kurzfristigen Forderungen (Zahlungsverpflichtungen), so ist dies ein Hinweis darauf, dass die Zahlungsfähigkeit zumindest am Bilanzstichtag gewährleistet war. Daraus lässt sich folgern, dass die Gefahr von Liquiditätsengpässen in Zukunft zumindest etwas geringer ist. Eine andere Finanzierungsregel besagt, dass betriebsnotwendiges Vermögen (Immobilien, Maschinen, Mindestbestände etc.) durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt sein sollte.
Täglicher Liquiditätsstatus
Neben dieser vergangenheitsorientierten Betrachtung existieren drei Formen der vorausschauenden Finanzplanung, die sich durch den Zeithorizont der Planung unterscheiden. Die kurzfristigste Form ist die Liquiditätsplanung. Sie ermittelt für jeden einzelnen geplanten Geschäftsvorfall die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen auf Tagesbasis. Ausgehend vom aktuellen Finanzmittelbestand (Bank und Kasse) werden die voraussichtlichen Bestände für die folgenden Tage durch die taggenaue Hinzurechnung von Einzahlungen und den Abzug von Auszahlungen ermittelt. Im Falle negativer Bestände können Kontokorrentlinien rechtzeitig ausgedehnt werden oder überschüssige Mittel gewinnbringend angelegt werden. Dieses Verfahren eignet sich für Planungen bis zu einem Monat, da sich Zahlungen bezüglicher ihrer genauen Höhe und des Zahlungszeitpunktes auf längere Sicht nicht mehr zuverlässig genug vorhersagen lassen.
Monatlicher Finanzplan
Aufgrund der abnehmenden Prognosegüte stellt der Finanzplan die Ein-/Auszahlungen eines Monats in einer Summe dar. Unterschieden wird nur mehr nach unterschiedlichen Arten von Zahlungen. So werden beispielsweise sämtliche Auszahlungen infolge des Einkaufs von Material im Finanzplan in einer Zahl ausgewiesen. Informationsbasis für die Planungen sind insbesondere Produktions- und Absatzpläne. Als erstes Ergebnis erhält man im Finanzplan den voraussichtlichen Kapitalüberschuss bzw. -fehlbetrag für jeden Monat des Planungszeitraumes, der zumeist zwölf Kalendermonate beträgt. Da insbesondere Fehlbeträge Anpassungsmaßnahmen nach sich ziehen müssen, werden in einem zweiten Schritt solche Maßnahmen mit eingeplant, die sich auf Posten des Umlaufvermögens (Kasse, Bank, Forderungen etc.) oder die kurzfristigen Verbindlichkeiten beziehen. Am Ende sollte ein für alle Planungsmonate ausgeglichener Finanzplan stehen (>> Abschnitt 4.1.2 in Band 3).
Читать дальше