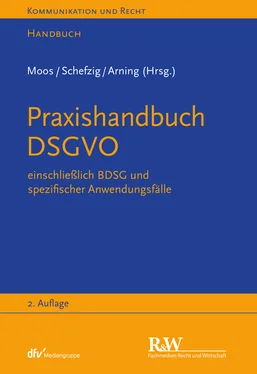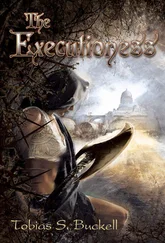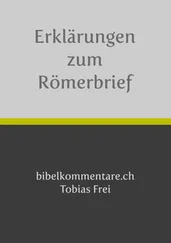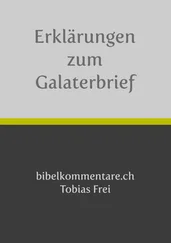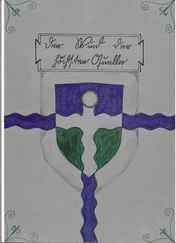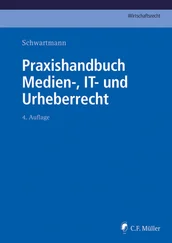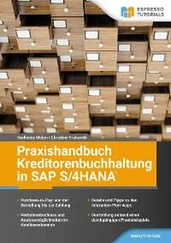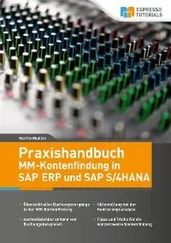Das Datenschutzrecht ist eine komplexe Materie. Nichtsdestoweniger sollte sich auch der Datenschutzpraktiker eine eigene Meinung dazu bilden, wie bestimmte Normen auszulegen sind. Denn weder die Datenschutzbehörden noch besonders profilierte Rechtswissenschaftler haben eine Deutungshoheit bezüglich der Auslegung von Normen.16 Zwar sollte das Unternehmen schon aus Haftungsgründen die entsprechenden Stellungnahmen seiner zuständigen Aufsichtsbehörde kennen und in Entscheidungen einbeziehen, doch muss der Anwender im Unternehmen nichtsdestoweniger eine eigene Wertungtreffen. Diese Wertung sollte – jedenfalls bei wichtigen Fragestellungen – im Hinblick auf die Rechenschaftspflichtgemäß Art. 5 DSGVO17 auch dokumentiert werden.
1. Auslegung der DSGVO
a) Autonome Auslegung des Unionsrechts
23
Aus den Anforderungen sowohl der einheitlichen Anwendung des Unionsrechts als auch des Gleichheitsgrundsatzes hat der EuGH seit jeher gefolgert, dass die Begriffe einer Vorschrift des Unionsrechts, die für die Ermittlung ihres Sinnes und ihrer Tragweite nicht ausdrücklich auf das Recht der Mitgliedstaaten verweist, in der Regel in der gesamten Union eine autonome und einheitliche Auslegungerhalten müssen.18 Eine schlichte Übernahme bestimmter, im nationalen Recht etablierter Interpretationen verbietet sich also.
24
Grundsätzlich wenden die europäischen Gerichte die gleichen Auslegungsmethoden an wie die deutsche Rechtswissenschaft. Neben der Auslegung auf Grundlage des Wortlauts finden also die systematische, die teleologische und die historische Auslegung Anwendung. Allerdings unterscheiden sich die Gewichtung und konkrete Anwendung dieser Methoden nennenswert von der deutschen Vorgehensweise. Darüber hinaus spielt regelmäßig das „ effet-utile-Prinzip“ im Europarecht eine große Rolle.
25
Auch im europäischen Recht stellt die Interpretation des Wortlautseiner Norm die grundlegende Auslegungsmethode dar. Allerdings ist schon umstritten, ob sie auch die wichtigste ist.19 Jedenfalls stellt der Wortlaut prinzipiell den Ausgangspunkt und die Grenze der Auslegung von Normen dar.20 Nichtsdestoweniger hat der EuGH in einzelnen Entscheidungen Auslegungen entwickelt, die die Rechtswissenschaft eher als Rechtsfortbildung denn als Rechtsauslegung bewertet hat.21
26
Darüber hinaus sind bei der Auslegung des Wortlauts einer Norm des Unionsrechts die Besonderheiten des europäischen Rechts als supranationales und multilinguales Rechtssystemzu berücksichtigen. Die verschiedenen sprachlichen Versionen der europäischen Gesetze sind gleichrangig.22 Weder aus der Zahl der Bevölkerung, die eine gewisse Sprache spricht, noch aus sonstigen Umständen lässt sich herleiten, dass eine Sprachfassung gültiger ist als eine andere. Darüber hinaus legt der EuGH die unionsrechtlichen Begriffe unabhängig von der Verwendung dieser Begriffe in einzelnen Mitgliedstaaten aus.23
Praxishinweis
Bei der Auslegung der DSGVO sollten auch andere SprachfassungenBerücksichtigung finden. Im Fall von Unstimmigkeiten sind beide Versionen gleich gültig. Der Wortlaut ist dann unstimmig. Widersprüche lassen sich nicht durch eine Auslegung der verschiedenen Sprachfassungen auflösen, sondern nur durch die Anwendung der anderen Auslegungsmethoden. Obwohl die Trilogverhandlungen auf Englisch geführt wurden, geht also die englische den anderen Sprachfassungen bei der Auslegung des Wortlauts nicht vor. Diese Tatsache kann alleine im Rahmen der teleologischen oder systematischen Auslegung Berücksichtigung finden.
bb) Teleologische Auslegung
27
Eine besonders wichtige Auslegungsmethode der europäischen Gerichtsbarkeit ist die Auslegung von Normen anhand des Gesetzeszwecks. Diese Auslegungsmethode hat in der europäischen Rechtsprechung eine weitaus größere Bedeutung als in der deutschen und sie wird teilweise auch als bei Weitem wichtigste Auslegungsmethode gesehen.24
28
Zur Bestimmung des Ziels einer Norm greift der EuGH insbesondere auf die entsprechenden Erwägungsgründezurück.25 Dabei leitet der EuGH aus diesen Erwägungsgründen vereinzelt sogar selbstständige Rechtssätze ab.26 Punktuell korrigiert oder ergänzt der EuGH die Erwägungsgründe auch anhand der relevanten Regelungen der Verträge.27
29
Falls die Erwägungsgründe unergiebig sind, stellt der Gerichtshof hinsichtlich des Zwecks einer Norm auch auf den Zusammenhang des Textesab. Er bezieht dabei weitere Normen des jeweiligen Gesetzes in seine Auslegung mit ein und identifiziert deren Ziele und die Auswirkungen des Gesamtsystems. Diese Auswirkungen sieht er grundsätzlich als vom Gesetzgeber intendiert an und verbindet auf diese Weise eine teleologische mit einer systematischen Auslegung.28
30
Auch in datenschutzrechtlichen Leitentscheidungenhat die teleologische Auslegung bereits eine wichtige Rolle gespielt. So hat der Gerichtshof z.B. in seiner „Safe Harbor“-Entscheidungentscheidend auf den Zweck der Art. 25 und 28 RL 95/46/EG abgestellt, um sein Ergebnis zu begründen.29 Dabei hat er auch auf Art. 8 GRCh zurückgegriffen, um diesen Zweck herzuleiten.30 Auch für die Auslegung des Begriffs „personenbezogenes Datum“ war eine Auslegung auf Grundlage des entsprechenden Erwägungsgrunds entscheidend.31
cc) Systematische Auslegung
31
Die systematische Auslegungerschließt den Regelungsgehalt einer Norm durch ihre Position und ihre Funktion innerhalb der Normen und des Systems des jeweiligen Textes.32 Innerhalb der DSGVO wäre beispielsweise die Auslegung eines Begriffs in einem Artikel anhand der entsprechenden Begriffsdefinition in Art. 4 DSGVO ein Fall der systematischen Auslegung.
Ein besonderer Fall der systematischen Auslegung des Unionsrechts ist die vertragskonforme Auslegung des Sekundärrechts.33
32
Insbesondere im Hinblick auf die RL 95/46/EG hat der Gerichtshof bei seiner Auslegung auch bereits auf Art. 8 GRChzurückgegriffen und aus dieser die Zwecke einer Norm hergeleitet.34 Er sprach insoweit von einer Auslegung „im Lichte der Charta“.35 Es handelte sich wohl um eine systematische Auslegung, die darauf abzielte, den Gesetzeszweck für eine teleologische Auslegung herzuleiten.
Beispiel
Ein aktuelles Beispiel, in dem die systematische Auslegung eine große Rolle spielt, betrifft die Bestimmung der datenschutzrechtlichen Anforderungen an den Einsatz von Cookies. Im Zusammenhang mit der Auslegung der Anforderungen nach Art. 5 Abs. 3 RL 2002/58/EG hat der EuGH in seinem Urteil in Sachen Planet49 konstatiert, dass bei der Auslegung einer Vorschrift des Gemeinschaftsrechts neben Wortlaut und Zielen auch der Kontext und das gesamte Unionsrechtzu berücksichtigen seien.36 Das könnte zur Folge haben, dass bei der Frage der Anwendung von Art. 6 DSGVO durchaus auch dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass in Art. 5 Abs. 3 RL 2002/58/EG ein explizites Einwilligungserfordernis enthalten ist.
dd) Historische Auslegung
33
Die historische Auslegung sucht den wahren Willen des Gesetzgebers(subjektiv-historische Auslegung) oder die historische Funktion einer Norm unter Betrachtung ihrer Entstehungsgeschichte zu ergründen (objektiv-historische Auslegung).37 Jedenfalls im Falle des Sekundärrechts, also auch der DSGVO, wenden die europäischen Gerichte auch diese Auslegungsmethode an.38
Читать дальше