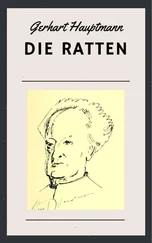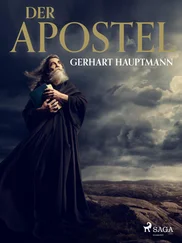So ist diese Badereise zu Ende gegangen.
*
Aus einer zweiten Badereise im Jahr darauf, die mich und den Vater nach Teplitz führte, würde, was unsre psychische Verfassung anlangt, nur eben das gleiche zu berichten sein. Ein Punkt vielleicht ist nicht ganz bedeutungslos, um als neu und besonders erwähnt zu werden, wenn man die Folgen durch ein ganzes Leben ins Auge fasst. Mein Vater gewöhnte mich ans Biertrinken.
Dem schönen böhmischen Bier, besonders dem aus Pilsen, ist die Schuld daran beizumessen. Überall wurde es serviert. Es leuchtete allzu freundlich kristallen-hell, schmeckte allzu edel und rein, um sich als ungesund zu erweisen.
Am dritten Tage verlangte ich schon mit Ungeduld, was mir am ersten noch widerstanden hatte. So kam es, dass neben Vaters vollem Glas immer das meine, ein ebenso großes, stand. Der Eigensinn meines Vaters ging darauf hinaus, mich auch gegen den Alkohol beizeiten fest zu machen.
Daraufhin sprach ihn eines Abends im Restaurant, wo wir saßen, ein Fremder an. Ob es für mich kleinen Knaben wohl gut sein könne, ein ganzes Glas Bier zu trinken. Ja, sagte mein Vater, ich wäre ein etwas blutarmes Kind, und dieses Gemisch von Malz, Hopfen und Alkohol sei als Medizin zu betrachten. Der Fremde schwieg und zuckte die Achseln. Mein Vater war ein zu streng aussehender, ernster Mann und benahm ihm den Mut, sich nach einer solchen Erklärung noch mit ihm einzulassen.
1 Ein Landauer ist eine viersitzige und vierrädrige Kutsche mit einem meist in der Mitte geteilten, klappbaren Verdeck. <<<
Am 13. Juli 1870 reiste mein Vater für einen Tag nach Dominium Lohnig und nahm mich mit. Aus welchem Grunde er diesen für ihn ungewöhnlichen Besuch machte, weiß ich nicht. Das Verhältnis zwischen ihm und Onkel Gustav Schubert war achtungsvoll, aber man hatte sich nicht sehr viel zu sagen. Grade darum muss die Ursache von Bedeutung gewesen sein.
Die langen Gespräche zwischen Vater und Onkel hinter verschlossenen Türen, die kurz bemessene Frist des Aufenthalts und der Ernst, der auch beim Abendessen nicht aus den Mienen der Männer wich, ließen die alte Spielfreude zwischen Vetter Georg und mir diesmal nicht aufkommen. Morgens darauf brachte uns Onkel in der üblichen Landkutsche nach Striegau zur Bahn, eine Fahrt, die mehrere Stunden verlangte. Ich weiß nicht, wer es war, der uns in einer gleichen Kutsche entgegenkam, sie halten ließ und uns zuwinkte.
Das Dumpfe, das über der ganzen Reise gelegen hatte, löste, wie Gewitterschwüle ein erster Blitz, die Nachricht, die der Winkende mitbrachte. »Meine Herren«, rief er, »wir haben den Krieg! Gestern hat König Wilhelm in Bad Ems den Gesandten Napoleons, der ihn wie einen Lakaien Frankreichs behandeln wollte, einfach auf die Straße geworfen. Die gesamte norddeutsche Armee mobilisiert, auch die süddeutschen Fürsten machen mit, Bayern, Baden, Württemberg. Es braust ein Ruf wie Donnerhall!«
Mein Vater und Onkel Schubert waren bleich geworden.
Damals stand ich noch vor Vollendung des achten Lebensjahres, aber es war nicht schwer zu begreifen, dass sich etwas ganz Ungeheures, Grundstürzendes ereignen sollte. Und nun wurde im Weiterfahren zum ersten Mal zwischen Vater und Onkel der Name Bismarck laut, ein Name, den mein Bewusstsein bis dahin nicht registriert hatte. »Bismarck,« sagte der Onkel, »stürzt uns in ein sehr schlimmes und sehr gefährliches Abenteuer hinein. Der Allmächtige sei uns gnädig! Weder sind wir gerüstet genug, aber wenn wir es wirklich wären, wie wollen wir den überlegenen Waffen und Massen Frankreichs widerstehen?«
Dem weichen und gütigen Onkel Gustav Schubert gegenüber schien mein Vater ein ebenso sanftes und wiederum gänzlich verändertes Wesen zu sein, aber er wollte doch nicht in die Verzagtheit des lieben Verwandten einstimmen. Mit ruhigen und bestimmten Worten trat er für Bismarck und seine Haltung ein: er habe immer gewusst, was er wolle, und es immer zum guten Ende geführt. Er nannte dann Moltke, Roon, Vogel von Falckenstein und erklärte, wenn wirklich Bayern, Württemberg, Baden und Sachsen mitgingen, hätte der Sieg eine große Wahrscheinlichkeit.
*
Man schrieb den 25. November 1870, als der Brunneninspektor Ferdinand Straehler, mein Großvater, starb. Die Depeschen König Wilhelms, die Nachrichten glänzender Siege und wieder Siege waren noch an sein Ohr geschlagen: die Erstürmung von Weißenburg, die der Spicherer Höhen, die Siege bei Wörth, Gravelotte und St. Privat, schließlich die Kapitulation von Sedan.
Das bedeutete die Heraufkunft einer neuen Zeit. Er stand vor dem Abschluss einer alten, die zugleich mit dem seines Lebens vollendet war.
Einigermaßen feierlich pilgerte ich mit meiner Mutter in das Sterbehaus. Tante Gustel und Tante Liesel hatten verweinte Augen. Schweigend begaben wir uns in ein hinteres Zimmer des Dachrödenshofs, das nach meiner Erinnerung nur durch ein Guckloch oben in der Wand Licht erhielt. Es war Ende November, aber ein sonnenheiterer, frischer Tag.
Etwas unter einem leinenen Bettuch Verborgenes hatte für mich eine schauerliche Anziehungskraft. Man deckte es ab, und ich sah eine mir zunächst unverständliche Masse, die langsam durch einen Fuß, durch eine gelbe runzlige Hand, durch etwas Haupthaar und Ohr als menschliche Form zu erkennen war. Es waren die irdischen Reste meines Großvaters.
Man hatte den Toten mit großen Blöcken Eises umlegt. Ich war nicht gerührt. Hätte meine Empfindung Ausdruck gefunden, vielleicht würde es durch ein befremdetes Kopfschütteln geschehen sein. Ich war wirklich ganz ein befremdetes Kopfschütteln.
Die tote Masse, die da lag, zwischen Eisstücken – konnte sie mein Großvater sein und gewesen sein? Das war er gewesen, er, dessen stolze Gleichgültigkeit mich verletzt, dessen ganze Erscheinung mir aber doch Ehrfurcht erweckt hatte? Also das war unser aller Los! Man hatte wohl Grund, sich das gegenwärtig zu halten.
*
Die Stunden darauf vereinigten äußerste Aktivität im Spiel und verschwiegene Meditationen, wie denn vielleicht überhaupt Träumerei und Aktivität vielfach verbunden sind.
Es gab einen rötlich gestrichenen hohen Karren mit zwei Rädern in unserm Hof. Ich bespannte ihn mit etwa acht Jungens zu vier und vier und stand, eine Peitsche schwingend, darauf. Ein Wirrsal von Zuckerschnüren ersetzte die Zügel. So rasten wir polternd über die Dorfstraße, rasten in den Posthof hinein, wo die Rosskastanien mit dem Gold ihrer Blätter den Boden verdeckt hatten und braune Früchte in Menge herumlagen. Dort beluden wir, von Sonnenschein und Herbstfrische belebt, unsern Karren mit Laub, um ich weiß nicht was damit auszurichten. Und nun rasten wir wieder dorthin, wo wir herkamen. Äußerlich war es für mich ein herrlicher Rausch. Im Innern jedoch hatte sich eine ungesuchte Erkenntnis wie ein Pfeil eingebohrt, ein Zustand, der sich nicht ändern konnte. Den Pfeil zu entfernen, die Wunde zu heilen, gab es keine Möglichkeit.
Читать дальше