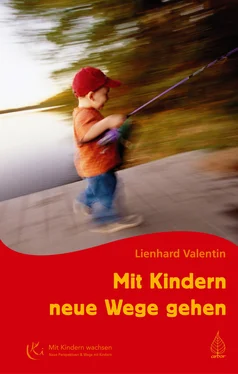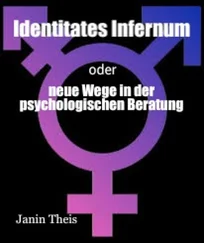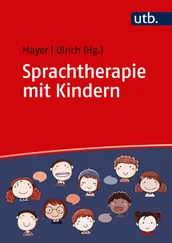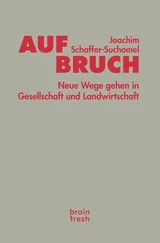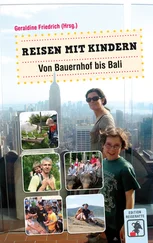Was hat sich in diesen beiden Fällen nun wirklich abgespielt? Handelt es sich tatsächlich um eine angemessene, konsequente Begleitung, die die Autonomie des Kindes respektiert? Ich glaube das ganz und gar nicht!
• Beginnen wir mit dem ersten Beispiel: Ging es hier um die autonome Bewegungsentwicklung? Das Kind konnte bereits frei gehen! Das Kindermädchen wollte das Kind also keineswegs aufstellen und ihm das Gehen beibringen oder ihm beim Gehenlernen helfen. Daß es an die Hand genommen werden wollte, war ein Ausdruck der Freude, sich nun gemeinsam auf den Weg machen zu können. Wenn ich mir diese Situation aus Sicht des Kindes ansehe, werde ich sehr traurig und resigniert: Meine Mutter läßt es nicht zu, daß mich das von mir so geliebte Kindermädchen an die Hand nimmt. Sie schimpft nicht, sie ist nicht böse mit mir, aber sie läßt die Freude in mir nicht leben. Ich fühle mich nicht autonom und selbständig, sondern verlassen, hilflos und ohnmächtig.
• Im zweiten Beispiel ist die Antwort schon schwieriger, denn offensichtlich hat die Maßnahme ja funktioniert. Der Junge verhält sich nicht mehr so fordernd und fügt sich in den Ablauf des Kindergartens ein. Aber ich habe meine Zweifel, daß es sich hier um ein Beispiel erfolgreicher Konsequenz handelt. Daß etwas funktioniert, heißt noch lange nicht, daß es angemessen ist. Für mich ist es sehr viel wahrscheinlicher, daß auch dieser Junge innerlich resigniert hat, daß er aufgehört hat, um das zu kämpfen, was er eigentlich gebraucht hätte – was immer das gewesen sein mag. Ich habe nicht gesehen, wie der innere Zustand des Jungen nach diesem Vorfall wirklich aussah – ob er wirklich an innerer Sicherheit gewonnen hat.
Anna Tardos sagte einmal: „Es ist grundsätzlich wichtig zu verstehen, daß wir Selbständigkeit vom Kind nicht erwarten oder gar fordern dürfen, sondern daß wir ihm die Möglichkeit geben, so selbständig zu sein, wie es das von sich aus möchte. Sie ist also ein Angebot und keine Forderung, es muß nicht selbständig sein, denn wir können darauf vertrauen, daß es selbständig werden wird, sich von uns lösen wird, seinen Weg gehen wird, wenn es dafür bereit ist – wenn die Zeit reif ist.“
Bei anderer Gelegenheit erläuterte Anna Tardos in einem Elternseminar: „Wir sind sehr überzeugt von dem, was wir tun und wie wir es tun. Ich bitte Sie trotzdem, nicht einfach alles zu übernehmen, nur weil ich es gesagt habe und es vielleicht überzeugend klingt. Es ist immer besser für ein Kind, wenn seine Eltern etwas mit einem guten inneren Gefühl ‚falsch‘ machen, als sich einer Methode, einem Prinzip unterzuordnen und gegen das eigene Gefühl zu handeln.“
Kurz gesagt bedeutet dies, das Kinder nicht unter unseren Prizipien leiden sollten. Für Prinzipien wurden Kriege geführt und Menschen getötet. Wenn wir Kindern auf wahrhaft menschliche Weise begegnen wollen, ist es unerläßlich, daß wir die vermeintliche Sicherheit, die uns solche Prinzipien geben, hinter uns lassen und uns den Kindern immer wieder von Neuem wirklich zuwenden.
Wenn wir uns auf Prinzipien berufen und uns vorrangig an solchen orientieren, werden wir herzlos, so einleuchtend und richtig uns diese Prinzipien auch erscheinen mögen. Dies ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, mit jedem Kind und jeder Situation wirklich in Kontakt zu treten, uns einzufühlen und zu lernen, mit den Augen des Herzens zu sehen und so gemeinsam mit unseren Kindern zu wachsen.
Doch wie ist das möglich? Wir können nicht warten, bis wir uns vervollkommnet haben, um dann gute Eltern oder Pädagogen zu sein. Unsere Kinder und ihre Bedürfnisse sind eine konkrete Wirklichkeit und Verantwortung, der wir uns heute stellen müssen.
Statt in unserer Ratlosigkeit möglichst schnell nach einem Rezept Ausschau zu halten, könnten wir vielleicht zunächst einmal innehalten und versuchen, unsere Situation genauer zu betrachten. Wenn wir Kinder als eigenständige Menschen sehen und mit ihnen in eine wahrhaft menschliche Beziehung treten möchten, und wenn wir erkennen, daß eine wirkliche Entfaltung des menschlichen Potentials die Frucht eines Reifeprozesses ist, versteht es sich von selbst, daß wir dies nicht durch die Anwendung irgendwelcher Erziehungsmethoden von außen bewerkstelligen können. Stattdessen können wir nach den Bedingungen fragen, die eine harmonische Entfaltung der Kinder ermöglichen, und welche Verhaltensmuster und Sichtweisen dazu führen, daß wir Kinder eher als Objekte behandeln und so den Kontakt zu ihnen verlieren.
Ein typischer Zeitpunkt, wenn Eltern anfangen, nach wirkungsvollen Lösungen zu suchen, ist, wenn Kinder anfangen, ein eigenes Ich, einen eigenen Willen zu entwickeln. Dies geschieht gewöhnlich um das zweite Lebensjahr herum – manchmal früher, manchmal später. In der Literatur wird diese Zeit die „Trotzphase“ genannt, und Kinder, die sich in dieser Phase befinden, werden gern als kleine Tyrannen bezeichnet, die dann durch die verschiedensten Methoden gezähmt werden sollen. Tatsächlich werden diese Kinder einfach selbständig, und wer trotzig wird, sind eher die Erwachsenen. Oft beginnen sich Kinder einfach nur gegen bestimmte Verhaltensweisen oder Umstände aufzulehnen, die ihren Bedürfnissen nicht entsprechen. So läßt sich ein Kleinkind vielleicht plötzlich nicht mehr ohne weiteres wickeln, was durchaus seinen Grund haben mag, wenn wir uns einmal genauer ansehen, in welcher Atmosphäre dieses stattfindet und wie einfühlsam und respektvoll unsere Hände dabei gewöhnlich sind. Oder es möchte seine Umgebung möglichst gründlich erforschen und wehrt sich dagegen, wenn es ständig davon abgehalten wird.
Wir können davon ausgehen, daß zweijährige Kinder in den seltensten Fällen einen Machtkampf vom Zaum brechen oder uns tyrannisieren wollen. Sie sind einfach, was sie sind. Und wenn wir ihnen den Raum und die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die sie brauchen, und uns ihnen einfühlsam zuwenden, verwandeln sich die sogenannten kleinen Tyrannen in aufgeweckte und sehr selbständige Forscher, an denen wir nur unsere Freude haben können.
Natürlich gibt es auch Kinder, die besondere Schwierigkeiten damit haben, daß die Welt und andere Menschen nicht nach ihrem eigenen Willen funktionieren. Ihre Wutanfälle treten nicht nur dann auf, wenn sie von uns nicht bekommen, was sie wollen, sondern auch, wenn die Wand einfach nicht weichen will, gegen die sie mit ihrer Schubkarre stoßen. Aber auch solchen Kindern ist nicht geholfen, wenn wir ihnen mit dem neuesten Ratgeber zum Grenzensetzen oder Festhalten zu Leibe rücken, sondern auch sie brauchen eine verständnisvolle, mitfühlende Begleitung, die ihnen hilft, anzunehmen, daß die Welt nicht immer so sein kann, wie sie es gern hätten. Manchmal ist ihnen mehr geholfen, wenn wir ihren Anfällen keine besondere Beachtung schenken und einfach die Situation beschreiben: „Die Wand will einfach nicht weggehen, nicht wahr?“ Welches Verhalten in einer solchen Situation jeweils angemessen ist, läßt sich natürlich nicht pauschal sagen, aber wenn wir nicht nur darauf aus sind, daß ein Kind unseren Erwartungen gemäß funktioniert und uns wirklich in die Situation einfühlen, finden wir meistens auch eine Lösung.
Wenn Kinder früher so funktionierten, wie es die Erwachsenen erwarteten, war das ein Erziehungserfolg, und die Eltern durften sich auf die Schultern klopfen. Lief es nicht wie gewünscht, so waren die Kinder schwierig und die Eltern wurden bemitleidet, wie schwer sie es mit diesem Kind hatten. Heute wissen wir, daß dies eine sehr einseitige Sicht war, und es geht darum, Wege zu finden, eine Beziehung zu unseren Kindern aufzubauen, die von gleicher Würde und gegenseitigem Respekt geprägt ist.
Wie aber könnte eine neue Beziehungsqualität aussehen? Welche Voraussetzungen liegen ihr zugrunde und wie könnten wir sie in unserem täglichen Leben verwirklichen? Wie können wir lernen, uns unseren Kindern immer wieder voll und ganz zuzuwenden – ihnen mit Achtsamkeit, Mitgefühl, Liebe und Respekt zu begegnen? Was brauchen wir selbst, um einen solchen Weg gehen zu können, und wie können wir die Folgen unserer eigenen Erziehung hinter uns lassen?
Читать дальше