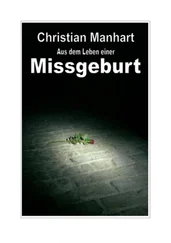RACHEL NAOMI REMEN
Dem Lebenvertrauen
Geschichten, die gut tun
Aus dem Amerikanischen von Lothar Schneider

© 1996 Rachel Naomi Remen
© 2013 der deutschen Ausgabe: Arbor Verlag GmbH Freiburg
by arrangement with Riverhead Books, a member of Penguin Group
(USA)
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel:
Kitchen Table Wisdom
Alle Rechte vorbehalten
E-Book 2020
Titelfoto: © 2013 borchee/istockphoto.com
Lektorat: Lothar Scholl-Röse
Hergestellt von mediengenossen.de
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
www.arbor-verlag.de
ISBN E-Book: 978-3-86781-285-6
INHALT
Vorwort
ERSTER TEIL
Lebenskraft
Pflaumenblüten
Der Wille, zu leben
Ein Platz in der ersten Reihe
Stil
Stille
Zwischen den Zeilen lesen
Ein aufgestauter Fluss
ZWEITER TEIL
Urteile
Das Richtige tun
Begegnung mit Mr. Richtig
Zurück zu den einfachen Dingen
Das Gegenteil von Perfektion
Ein ganz gewöhnlicher Held
Ärzte weinen nicht
Wer ist dieser Mann hinter dem Mundschutz?
Das Wehwehchen küssen
Die Babyküsserin
Durch Zuneigung heilen
Etiketten
Wasser auf die Mühlen
Der Wald, „in dem nichts einen Namen hat“
DRITTER TEIL
Fallen
Heilen aus der Distanz
Das Spiegelbild
Der Lotteriegewinn
Ein Beutel voller Gold
Ein Taschenspielertrick
Des Kaisers neue Kleider
Vor dreißig Jahren …
VIERTER TEIL
Freiheit
Der lange Weg nach Hause
Die Vase
Eine andere Art Stille
Heimkehren
Erinnerungen
FÜNFTER TEIL
Sich dem Leben öffnen
Mentalitätsunterschiede
Einfach zuhören
Im Flugzeug
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“
Rituale
Selbstbefreiung
Berge versetzen
Dem Leben einen Sinn geben
Tradition
Manches gehört uns für immer
SECHSTER TEIL
Das Leben umarmen
Dreihundertzweiundvierzig Stufen
Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen
Das Leben gehört den Gesunden
Zimmer mit Aussicht
Drei Fabeln über das Loslassen I
II.
III.
Endanfänge
Die Waffen strecken
Fixierung oder Bindung
Den Keks essen
Wähle das Leben!
Fixierung oder Bindung II
Alles oder nichts
Das Leben umarmen
SIEBTER TEIL
Die Kraft des Zuhörens
Das Leben ist ein Prozess
Engagement für das Leben
Sehen statt deuten
Berühren
Der Treffpunkt
Der „Heilige Schatten“
Einander heilen
Das Geschenk
ACHTER TEIL Gott verstehen
Wenn Gott zwinkert
Das Passahmahl
Gebete
Großmutter Eva
Der Rabbi des Rabbi
Zufluchtsorte
Gott ist in allem
Jeder ist einzigartig
NEUNTER TEIL
Geheimnisse
Freiheit
Die Frage
Vom guten und vom wahren Grund
In der Dunkelheit
Der Blick um die Ecke
Heilige Momente
Das Geheimnis
Die letzte Lektion
Nachwort
Dank
Für alle,die noch nie ihre Geschichteerzählt haben
VORWORT
Mein Großvater hat mich schon sehr früh und auf eine Art, die einem Sokrates entsprochen hätte, dazu angehalten, nach der Wahrheit zu suchen. In Großvaters Welt, die von einem immanenten und persönlichen Gott bewohnt wurde, verlebte ich den einen Teil meiner Kindheit. Er war ein ernster und gelehrter Mann und schon ziemlich alt, als ich geboren wurde – ein orthodoxer Rabbi, der den größten Teil seiner Zeit damit verbrachte, die Texte des mystischen Judaismus zu lesen. Die Bücher der Kabbala, die er aus Russland mitgebracht hatte, waren alt und in hebräischer Sprache mit der Hand auf sehr dünnes Papier geschrieben. Als kleines Kind saß ich unter dem Tisch, an dem er sie las, streichelte seine purpurroten Samtpantoffel und träumte vor mich hin.
Das andere Reich meiner Kindheit war die Welt der Medizin. Unter den Kindern und Enkelkindern meines Großvaters sind drei Krankenschwestern und neun Ärzte. Als junges Mädchen war ich davon überzeugt, dass erwachsen zu werden gleichzeitig bedeutete, Ärztin zu werden. Ich lernte früh, die „richtigen“ Antworten zu geben, wenn ich gefragt wurde, was ich später einmal werden wolle. Ich war die einzige künftige Ärztin in der Vorschule. Als mein Großvater starb, hinterließ er mir das Geld, das ich benötigte, um Medizin zu studieren. Damals war ich sieben Jahre alt.
Je älter ich wurde, desto mehr belasteten mich die Erwartungen, die meine Familie an mich stellte. Meine Onkel und Vettern waren Männer der Wissenschaft, zurückhaltend, gebildet, intellektuell und erfolgreich. Wie mein Vater belohnten sie mich, wenn ich in ihrem Sinne richtig antwortete. Mein Großvater hingegen hatte mich für die richtigen Fragen belohnt. Zwar bewunderte ich diese Doktoren, aber meinen Großvater und seine Art, Fragen an das Leben zu stellen, hatte ich geliebt. Mit zwölf Jahren wollten mein Lieblingsvetter und ich beide Rabbi werden. Er wurde Arzt, und ich wurde Ärztin.
Ich glaube, für die Medizin habe ich mich letztlich wegen eines Romans entschieden, den ich mit etwa zwölf Jahren las, eine Geschichte über den Evangelisten Lukas mit dem Titel Die Straße nach Bithynien. Historische Romane waren das LSD der Fünfzigerjahre, ein einfaches Rauschmittel für eine Generation von gelangweilten Nachkriegsjugendlichen. Ich war süchtig danach.
Ich hatte nicht gewusst, dass Lukas Arzt war. Die Straße nach Bithynien hatte mich ursprünglich angesprochen, weil mir die biblische Weihnachtsgeschichte in der Version des Lukasevangeliums am besten gefiel. Frank Slaughter, der Autor der Straße nach Bithynien, war ebenfalls Arzt, und er erzählte die Geschichte von Lukas mit einer Eindringlichkeit und Überzeugungskraft, die er seiner Erfahrung und Berufspraxis verdankte. Ich habe den Roman vier Mal gelesen und verblüfft festgestellt, dass keiner der darin geschilderten Ärzte so war wie meine Onkel und dass es möglich sein musste, den Arztberuf so auszuüben, wie es mein Großvater gutgeheißen hätte: als Möglichkeit, das Leben und den Ursprung des Lebens besser kennenzulernen und ihm zu dienen. Der Roman machte mir Hoffnungen, dass jemand wie ich seinen Platz in der Medizin finden könnte, ohne zwischen dem Leben meines Großvaters und dem seiner Söhne wählen zu müssen.
Der Tag, an dem alles anfing, ist mir lebhaft im Gedächtnis geblieben: Mein Vater, der meine Siebensachen in mein Zimmer des Studentenwohnheims trägt, meine Mutter, die meine Kleider auspackt und wie immer die Schubladen mit einem besonderen Papier auslegt – beide in trauter Eintracht arbeitend, bis es nichts mehr zu tun gibt. Ich erinnere mich an ihre besorgten Worte und daran, wie sich endlich die Tür hinter ihnen schloss. Wie gerne wären sie geblieben, hätten mit mir diese letzte Nacht vor dem Beginn meines Medizinstudiums verbracht. Aber mit zwanzig wollte ich diese Herausforderung allein bestehen.
Ich betrachtete die sorgsam gefalteten Kleidungsstücke, die leeren Bücherregale, das harte, schmale Bett und die glatte Oberfläche des Schreibtischs. Das Zimmer wirkte unpersönlich wie eine Klosterzelle, völlig anders als mein eigenes, feminin eingerichtetes Schlafzimmer, in dem ich noch die Nacht davor verbracht hatte. Vier Jahre lang würde ich nun hier zu Hause sein. In dieser Nacht fröstelte ich. Ich fühlte mich verlassen.
Читать дальше