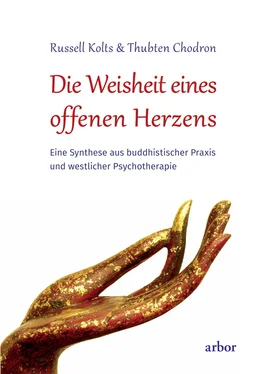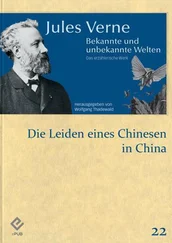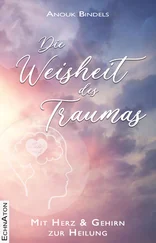Ich freue mich besonders darüber, dass dieses Buch Die Weisheit eines offenen Herzens gemeinsam von einem Psychologen und einer buddhistischen Nonne geschrieben wurde. Beider Traditionen sind reich an Wissen und Weisheit und können viel miteinander teilen und voneinander lernen. Da ich selbst seit vielen Jahren in den Dialog zwischen moderner Wissenschaft und buddhistischer Wissenschaft involviert bin, macht es mich froh, zu sehen, dass auch andere daran teilnehmen und das Gespräch bereichern. Die Autoren präsentieren das Thema „Mitgefühl“ in einer leicht verständlichen Sprache und auf eine Weise, die für jede und jeden umsetzbar ist, gleich, welchem Glauben (oder auch gar keinem) er oder sie sich zugehörig fühlt. Die kurzen Betrachtungen am Ende jedes Beitrags geben den Lesern und Leserinnen einfache und doch effektive Hinweise darauf, wie man anfangen kann, die segensreichste aller menschlichen Eigenschaften zu entwickeln und zu kultivieren: Mitgefühl.

Der Dalai Lama, 29. August 2013
Vorwort von Paul Gilbert
Die westliche Psychologie hat sich darauf konzentriert, den menschlichen Geist wissenschaftlich zu erforschen – vor allem den individuellen. Sie hat ihren Blick auf psychische Probleme, Aggression, Selbstsicherheit, Durchsetzungsvermögen und Selbstwertgefühl gerichtet, darauf, wie Menschen konkurrenzfähiger werden, schönere Körper und besseren Sex haben können. Tatsächlich mehren sich die Beweise dafür, dass wir im Laufe der vergangenen 30 Jahre immer selbstbezogener, habgieriger und narzisstischer geworden sind, zunehmend mit unserem Selbstgefühl und unserer Selbstdarstellung beschäftigt, ob in der „realen“ Welt bei der Arbeit oder der Partnersuche oder in der virtuellen Welt der sozialen Netzwerke. Wir wurden, wie der verstorbene Christopher Lash bemerkte, zu Theaterschauspielern, von Selbstkritik, Scham und Angst vor Zurückweisung gequält, wenn unsere „Performance“ nicht den Beifall der anderen findet. Unglücklicherweise führt unsere „Tu-mehr-habemehr-sei-mehr-Haltung“ nicht unbedingt zu größerer Zufriedenheit, sondern birgt ein erhöhtes Risiko, Depressionen und Angststörungen zu entwickeln, die in westlichen Ländern gerade unter jüngeren Menschen auf dem Vormarsch sind.
Was geschieht also, wenn wir das auf den Kopf stellen, das heißt, wenn nicht vor allem Selbstoptimierung der Schlüssel zum Glücklichsein ist, sondern Mitgefühl – der Wunsch, sensibel für das eigene Leiden und das anderer zu sein –, verbunden mit dem Wunsch, sich damit auseinanderzusetzen, es zu lindern und zu verhindern? Was geschieht, wenn wir das Leiden bei uns selbst und anderen nicht als Zeichen dafür betrachten, dass etwas „schiefgelaufen“ ist, oder als persönliches Versagen oder Schwäche, sondern stattdessen als einen normalen Lebensprozess, der von uns verlangt, Einsicht und Mut zu entwickeln.
Das war der Weg des Buddha vor etwa 2500 Jahren. Er wurde als Prinz geboren, und um ihn vom Leid der Welt fernzuhalten, ließ ihm sein Vater von hohen Mauern umgebene goldene Paläste bauen, in denen alle seine Wünsche erfüllt wurden: das beste Essen, der beste Wein, die schönsten Frauen. In den ersten 30 Jahren seines Lebens konnte er also ein Leben führen, in dem ihm alle weltlichen Freuden im Überfluss zur Verfügung standen. In gewisser Weise bekommen wir heute in den westlichen Gesellschaften ja gesagt, dass wir genau das tun sollen: mehr kaufen, mehr haben, mehr tun, mehr sein, und uns den Vergnügungen hingeben – Essen, Trinken, Urlaub, Autos, TV-Shows – und das Leid in unserem eigenen Herzen und bei anderen nicht so sehr beachten.
Doch Siddhartha (der künftige Buddha) ahnte, dass es jenseits der Mauern, jenseits aller seiner Vergnügungen etwas anderes gab. Und so schlich er sich eines Tages mit einem Diener aus dem Palast. Draußen begegnete er vier Botschaftern. Einem alten Mann, dessen körperlicher Verfall offensichtlich war, einem Kranken, der Schmerzen litt, und einem verwesenden Leichnam. Ihm wurde bewusst, dass, wie sehr man sich auch von den Vergnügungen oder Anforderungen des Lebens ablenken ließ, das Leiden letztendlich nie weit entfernt war. Der vierte Botschafter war ein heiliger Mann, den er in der Stadt umhergehen sah. Als Siddhartha seinen Begleiter fragte, wer dieser Mann sei, erwiderte der Diener, das sei ein heiliger Mann auf der Suche nach den Ursachen des Leidens und dem Ende des Leidens. Da begann der Buddha, sich für die Realität des Leidens zu öffnen, und er beschloss, ebenfalls die Ursachen des Leidens zu erforschen, den Weg zur Beendigung desselben zu suchen und den Dingen auf den Grund zu gehen.
Ich habe mich oft gefragt, ob ich an seiner Stelle denselben Weg gewählt hätte. Oder hätte ich mir gesagt: „He, Mann, die Hölle ist da draußen, außerhalb dieser Mauern. Ich werde hierbleiben und weiterhin den guten Wein und das Zusammensein mit den Frauen genießen, singen und tanzen und feine Kleider tragen“? Das tun die meisten von uns: Wir versuchen, das Leiden draußen zu halten, und hoffen, dass das Leben uns nicht allzu hart anfassen wird. Doch im tiefsten Innern wissen wir, dass das nicht wirklich funktioniert. Wir sehen, dass die Probleme in dieser Welt immer größer werden: Der Planet wird nach und nach zerstört, die Banken und andere Wirtschaftsunternehmen fördern die Habgier und anderes unmoralisches Verhalten, fügen dem sozialen Gefüge der Gesellschaft immensen Schaden zu, Waffenfabrikanten machen riesige Profite auf der Basis von Konflikten, von denen wir nicht wissen, wie wir sie lösen sollen, und Millionen Menschen sterben Jahr für Jahr an Hunger und vermeidbaren Krankheiten. Und wir wissen, dass wir auch in unserem eigenen Leben nicht gefeit sind vor wirtschaftlichen Unsicherheiten, Beziehungskonflikten und Trennungen, Enttäuschungen, Krankheiten, dem Altwerden und schließlich unserem eigenen Sterben und dem geliebter Menschen.
Was geschieht also, wenn wir einen völlig anderen Weg wählen, wenn wir aufhören, unseren Blick darauf zu richten, mehr, mehr, mehr zu haben, wenn wir uns umdrehen und die wahre Natur des Lebens betrachten? Was geschieht, wenn wir tatsächlich den Weg des Buddha wählen? Natürlich kommt uns da als Erstes der Gedanke: „Du musst verrückt sein! Wie kannst du von mir verlangen, dass ich der Existenz des Leidens auf den Grund gehe, wenn ich doch glücklich sein will und mir nichts anderes wünsche, als dass das Leiden verschwinden möge?!“ Aber die Wahrheit ist, dass wir, indem wir uns mit dem Leiden auseinandersetzen, unsere Fähigkeit zum Glücklichsein auf eine viel breitere Basis stellen. Bei der Auseinandersetzung mit den unbefriedigenden Aspekten des Lebens geht es nicht um ein masochistisches Vergnügen daran, uns im Elend zu suhlen, sondern um eine echte innere Reise der Veränderung. Und das Entwickeln von Mitgefühl ist das Herzstück dieser Reise.
Bis vor Kurzem mussten wir uns auf persönliche Aussagen verlassen, dass Mitgefühl tatsächlich die Bedingungen für größere Lebenszufriedenheit schafft, dass es zu mehr Harmonie in unseren Beziehungen beitragen kann, uns helfen kann, weniger selbstkritisch zu sein, weniger anfällig für Gefühle der Scham, dass es uns helfen kann, der Welt mit einer fürsorglicheren Haltung zu begegnen und zu innerem Frieden, zu Freude und Zufriedenheit zu finden. Dankenswerterweise hat sich, teilweise durch die Anregung des Dalai Lama, inzwischen die westliche Wissenschaft des Themas angenommen. Und es zeigt sich, dass das Entwickeln und Kultivieren von Mitgefühl für uns selbst und andere erstaunliche Dinge in unseren Gehirnen und Körpern bewirkt. Wenn wir Mitgefühl kultivieren, erhöht sich die Aktivität in bestimmten Hirnregionen, die mit positiven Gefühlen assoziiert werden. Außerdem wirkt es sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System und unser Immunsystem aus. Das Entwickeln von Mitgefühl dient also tatsächlich auch unserem körperlichen Wohl. Auch auf der geistigen Ebene hilft es uns, tiefere Einsichten in die Natur unseres Leidens zu gewinnen. Anstatt weiterhin selbstkritisch zu sein und anfällig für Schamgefühle, entwickeln wir eher Selbstakzeptanz, Einsichtsfähigkeit und Selbstfürsorge. Indem wir Mitgefühl in uns nähren, werden wir rücksichtsvoller und fürsorglicher in unseren Beziehungen sein, und diese werden eher gedeihen, wenn wir uns nicht ständig enttäuscht fühlen und Kritik üben.
Читать дальше