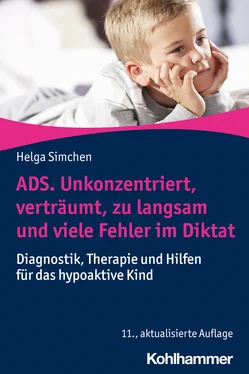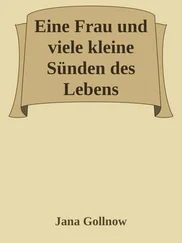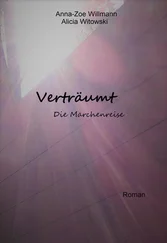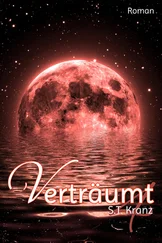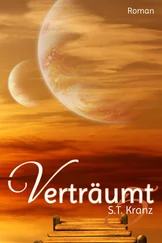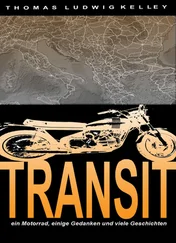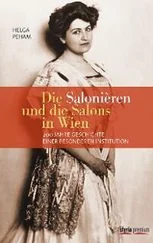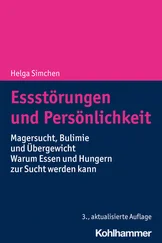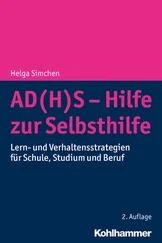• Entlastung der Eltern von Schuldgefühlen und Akzeptieren des Andersseins des Kindes
• Strukturierung und Konsequenz in der Erziehung, Vermittlung eines konsequenten, aber liebevollen Erziehungsstils
• Erarbeitung von Therapiezielen vor allen Dingen mit dem Kind und seinen Eltern unter Einbeziehung der Schule
• Anleitung der Eltern zur Mitarbeit als Co-Therapeuten nicht nur momentan, sondern auch für die nächsten Jahre
• Verhaltens- und Konzentrationstraining
• Soziales Kompetenztraining



 Für eine erfolgreiche Therapie sollte sich nicht nur das Kind in seinem Verhalten ändern, sondern auch seine Eltern.
Für eine erfolgreiche Therapie sollte sich nicht nur das Kind in seinem Verhalten ändern, sondern auch seine Eltern. 
Die Ziele der Behandlung sind:
• ein sozial angepasstes Verhalten, das dem Leistungsvermögen des Kindes entspricht
• der Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls durch eine veränderte Reaktions- und Wahrnehmungsweise
• die Zufriedenheit des Kindes mit sich selbst und seinem Umfeld
Schwerpunkte der Therapie bilden:
• die Beratung und Aufklärung der Eltern und des Kindes über ADS und seine Ursachen
• die verhaltenstherapeutische Begleitung
• das Training zur Beseitigung der Defizite (im motorischen Bereich – oft sind Fein-, Grob-, Sprach- und Visuomotorik betroffen –, der Konzentrations- oder der Teilleistungsstörungen wie Lese-Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche)
• die Gabe von Stimulanzien, sofern erforderlich
Hypoaktive Kinder kommen erfahrungsgemäß meist sehr spät in ärztliche Behandlung, wobei sie und ihre Eltern oft einen langen Leidensweg hinter sich haben. Nicht selten stand die Aufnahme in eine Sonderschule kurz bevor, trotz guter Intelligenz. Aufgrund ihres langsamen Arbeitstempos und ihrer schlechten Konzentration jedoch können sie den Schulstunden nicht folgen. Sie träumen vor sich hin und sind in Gedanken abwesend. Selbst wenn sie wollten, sie könnten nicht anders. Dieses Bild vom ADS ist bisher noch viel zu wenig bekannt. So fallen nur die Lernstörungen und die psychischen Beeinträchtigungen auf, die oft zu einem erheblichen Leidensdruck führen. Deshalb wird leider noch viel zu häufig nur symptomorientiert behandelt, ohne die wahre Ursache zu erkennen und zu beseitigen.
Erwünschte und mögliche Therapieerfolge beim Schulkind, die bei guter Mitarbeit von jedem hypoaktiven Kind erreicht werden können, sind:
• eine Verbesserung der schulischen Leistungsfähigkeit durch Steigerung der Konzentration, des Arbeitstempos, der Daueraufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnisses
• eine Verbesserung der Schrift
• Frustrationen können leichter ertragen und besser verarbeitet werden
• vieles, worum sich das Kind bisher erfolglos bemühte, gelingt ihm jetzt leichter und schneller. Es beginnt wieder Freude an der Schule und am Lernen zu haben
• durch seine veränderte Wahrnehmung und verbesserte Anpassung knüpft es wieder vermehrt soziale Kontakte. Es wird von Klassenkameraden akzeptiert, hat viel mehr Freunde und wird häufiger zu Geburtstagen eingeladen. Es fühlt sich nicht mehr als Außenseiter
• in der Familie wird es durch die Übernahme von Pflichten, durch das angemessene Signalisieren seiner Rechte mittels sozialem Kompetenztraining einen gleichberechtigten Platz unter den Geschwistern einnehmen
Wird zu spät behandelt, kommt es dagegen zu reaktiven Fehlentwicklungen mit der Gefahr der psychischen Beeinträchtigung.
Was ist eine reaktive Fehlentwicklung?
Eine reaktive Fehlentwicklung ist eine nachhaltige erlebnis-bedingte Störung der Person-Umwelt-Beziehung mit psychischer und/oder körperlicher Symptomatik, die infolge einer nicht mehr kompensierbaren, länger dauernden seelischen Belastung entsteht. Sie ist eine reaktive Störung mit Beeinträchtigung der Lebensqualität.
Beispiele reaktiver Fehlentwicklungen sind:
• Psychoreaktive Schmerzzustände (Kopf- und Bauchschmerzen)
• Ängste
• Schlafstörungen
• Einnässen
• Einkoten
• Magen-/Darmbeschwerden
• Essstörungen
• Stammeln und Stottern
• Tic-Erscheinungen und Grimassieren
Solche Fehlentwicklungen müssen ebenfalls in die Behandlung mit einbezogen werden. Um diese zu verhindern, ist bei ausgeprägter Symptomatik und großem Leidensdruck eine medikamentöse Therapie mit Stimulanzien von Anfang an erforderlich. Sie schafft in solchen schweren Fällen erst die Voraussetzung für eine erfolgreiche Verhaltenstherapie.
Wirkungsweise der Stimulanzien
Sie wirken im Bereich der Synapsen, wo sie die Menge der dort wirksamen körpereigenen Botenstoffe erhöhen und vor allem stimulieren sie die Bereiche des Gehirns bei denen eine Unterfunktion besteht. Dies entspricht etwa der Behandlung anderer Mangelerkrankungen, wie dem Mangel an Schilddrüsenhormon oder dem Insulinmangel bei der Zuckerkrankheit. Synapsen sind die Schaltstellen zwischen den Nerven, sie dienen der Weiterleitung von Reizen. Stimulanzien gleichen die Unterfunktion des Stirnhirns aus, Reizüberflutung wird vermieden, dadurch können sich wichtige Nervenbahnen im Gehirn besser vernetzen, was eine Automatisierung von Lernprozessen ermöglicht.
Eine medikamentöse Behandlung wird bei hyperaktiven Kindern in den USA seit 1937 und in Deutschland seit 1946 praktiziert, mit Ritalin seit 1971.
In den zurückliegenden 30 Jahren wurde bisher weder in den USA noch in Deutschland oder in einem anderen Land ein einziger Fall von Medikamentenabhängigkeit bei einem ADS-Kind bekannt.
Die medikamentöse Behandlung erfolgt mit den Stimulanzien Methylphenidat, d-Amphetamin und als Mittel der zweiten Wahl mit Strattera, einem Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer in den Synapsen (siehe dazu auch den Absatz im Kapitel 
Medikamentöse Therapie
). Diese Medikamente regen wichtige Zentren im Gehirn an, die ansonsten nur ungenügend arbeiten. Dies entspricht einer Substitutionstherapie, wie sie bei Unterfunktionen vieler Organsysteme gebräuchlich ist. Die Besonderheit dieser Behandlung liegt einerseits darin, dass das ADS im Kopf »angesiedelt« ist und andererseits an der Art des Medikaments. Wenn es von nicht ADS-Betroffenen genommen wird, kann es eine aufputschende Wirkung haben. Dagegen führt es bei ADS-Kindern zu weit reichenden Therapieerfolgen und nicht zur »Ruhigstellung« des Kindes. Die Medikamente sollten mit kontinuierlicher Wirkung über den ganzen Tag, auch an den Wochenenden und in den Ferien eingenommen werden. Nur so können die Lernbahnen, die durch die Therapie bereits angelegt wurden, stabil erhalten bleiben.
Nicht nur die hyperaktiven Kinder sollten bei ausgeprägtem Krankheitsbild eine Therapie mit Stimulanzien erhalten, sondern auch die hypoaktiven Kinder wie z. B. die brav träumerischen Mädchen (»Les enfants lunatiques«), ehe sie bleibende seelische Schäden davontragen. Natürlich wirken die Tabletten nicht von allein, eine verhaltenstherapeutische Begleitung der Patienten und ihrer Eltern ist unbedingt erforderlich.



Читать дальше