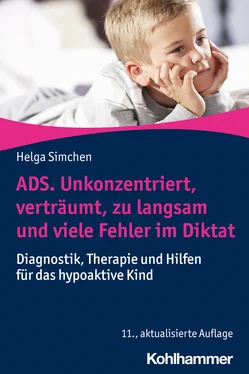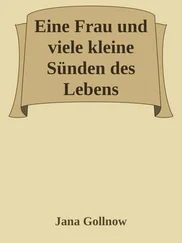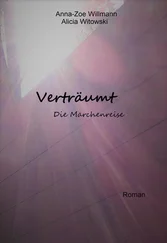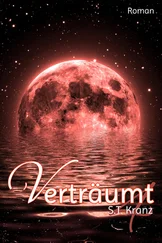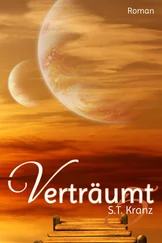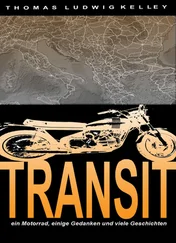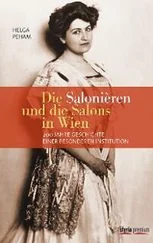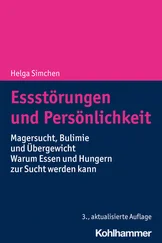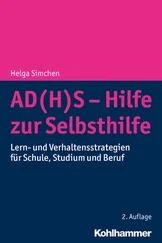Wesentlich ist immer eine deutliche Differenz zwischen dem vorhandenen individuellen Leistungspotenzial und der real in der Schule, im Kindergarten oder zu Hause erbrachten Leistung. Es muss eine deutliche Diskrepanz zwischen dem intellektuellen Leistungsvermögen des Kindes und dem bestehen, was es wirklich leistet und wie es sich verhält.
Eine ausführliche Anamnese erbringt fast immer Hinweise auf eine familiäre Veranlagung (Disposition). Wenn man diese Kinder genau beobachtet, zeigen sie schon in den ersten Lebensjahren Auffälligkeiten. Ihre Mütter sagen sehr häufig: »Das Kind war von Anfang an anders.«
Was zeigen viele hypoaktive Kinder bereits im Kleinkind- und Vorschulalter für Besonderheiten?
• motorische Auffälligkeiten im Säuglingsalter (krabbeln nicht, robben)
• Auffälligkeiten in der Mundmotorik (beim Trinken, sabbern viel und lange)
• Verzögerungen in der Sprachentwicklung
• verstärktes »Motzen« im 2. Lebensjahr
• wenig Kontaktaufnahme zu gleichaltrigen Kindern
• unmotiviertes Weinen
• Auffälligkeiten im Kindergarten: Rückzugs- und Regressionstendenzen, verbunden mit Problemen in der Fein- und Grobmotorik
• sie malen und basteln nicht gern
• sie ziehen sich aus dem Stuhlkreis zurück, weinen leicht, wirken ängstlich und unsicher
• sie spielen allein in der Puppenecke, haben nur wenige Kontakte zu anderen Kindern, weil die Eingliederung in die Gruppe für sie zu anstrengend ist
• sie haben oft über viele Jahre hinweg immer den gleichen Freund mit intensiver Beziehung
• sie klettern nicht gern und lernen nur schwer Rad fahren und schwimmen
• sie vergessen viel
• ihre emotionale Steuerungsfähigkeit, Daueraufmerksamkeit und verbales Reaktionsvermögen sind unter Belastung vermindert.
Diese Symptome müssen nicht alle bei hypoaktiven Kindern vorkommen! Aber aus der Summe vieler einzelner Symptome ergibt sich oft schon zeitig ein Verdacht, man muss nur darauf achten.
Wie wird nun das ADS mit Hypoaktivität festgestellt?
Hier sollte man unbedingt den Fachmann zu Rate ziehen, der erfahren und ausgebildet ist. Denn die Diagnostik basiert auf dem Erkennen und Beschreiben einzelner beeinträchtigter Hirnfunktionen, die möglichst über einen längeren Zeitraum von Jahren vorhanden sein sollten.
Das manifeste Bild eines ADS beinhaltet drei Ebenen:
• die neuromotorischen Funktionen
• die kognitiven Fähigkeiten
• die Verhaltensproblematik
Dazu können die verschiedenen Formen von Teilleistungstörungen und sekundären Fehlentwicklungen kommen.
Die Säulen der Diagnostik sind:
• die körperliche Untersuchung
• die neurologische Untersuchung einschließlich EEG
• die Entwicklungsdiagnostik mit Suche nach Lernfähigkeits- und Teilleistungsstörungen
• das Überprüfen der Fein- und Grobmotorik
• die Leistungsdiagnostik mit Entwicklungs- und Intelligenztests
• die psychologische Diagnostik mit Suche nach Hinweisen auf eine beginnende Fehlentwicklung mit Hilfe psychometrischer Verfahren
• das Bewusstmachen und Erkennen von besonderen Fähigkeiten des Kindes
• das Kennenlernen der Familiendynamik und des sozialen Umfeldes



 Die Diagnose eines ADS ohne Hyperaktivität kann weder mit Hilfe der sog. Conners-Skala noch mittels Fragebogen gestellt werden, sondern allein aus dem direkten Erleben des Kindes in verschiedenen Situationen, seiner Lebensgeschichte, der Familienanamnese, einer gründlichen neurologischen, psychiatrischen und psychologischen Untersuchung.
Die Diagnose eines ADS ohne Hyperaktivität kann weder mit Hilfe der sog. Conners-Skala noch mittels Fragebogen gestellt werden, sondern allein aus dem direkten Erleben des Kindes in verschiedenen Situationen, seiner Lebensgeschichte, der Familienanamnese, einer gründlichen neurologischen, psychiatrischen und psychologischen Untersuchung. 
Informationen zur Conners-Skala und zum Conners-Fragebogen
Conners ist ein amerikanischer Arzt und ADS-Spezialist. Er hat verschiedene Tabellen mit typischen ADS-Symptomen zusammengestellt, die dann je nach Ausprägungsgrad bewertet werden können. Dadurch sind annähernd vergleichbare Angaben über die Schwere des Betroffenseins und den Behandlungsverlauf möglich. Dieser orientierende ADS-Check ist allerdings sehr subjektiv. Eine fachärztliche Diagnostik kann damit nicht ersetzt werden. Der Conners-Fragebogen ist eine Punktwert-Tabelle mit einzelnen Eigenschaften, die bei ADS-Kindern vermehrt vorkommen und in der Summe typisch für ADS sind. Hypoaktive Kinder erreichen oft nicht die für ADS geforderte Punktzahl, weil sie ein ADS ohne »auffällige« Hyperaktivität haben.
Eine frühzeitige Diagnose erlaubt eine rechtzeitige Behandlung. Diese wiederum verhindert, dass Entwicklungsphasen ungenutzt verlaufen und es beim betroffenen Kind zu Defiziten kommt, die später nicht wieder oder nur ganz schwer aufgeholt werden können.
Die Therapie umfasst die Behandlung des Kindes und seiner Familie. Alle ADS-Kinder verfügen über viele Fähigkeiten, derer sie sich nur bewusst werden müssen. Diesen Kindern und Jugendlichen zu helfen, aus ihrer »Hypoaktivität« herauszukommen, muss das Ziel jeder ärztlichen Therapie sein.



 Wichtig: Das ADS ist keine Krankheit an sich, sondern die Kinder mit ADS sind eben anders, aber nicht schlechter, in manchem sogar besser. Unerkannt, in ausgeprägter Form und unter zu großer Belastung kann das ADS aber zur Krankheit werden mit schweren Folgen für die seelische und körperliche Gesundheit akut und für die Zukunft des betroffenen Kindes.
Wichtig: Das ADS ist keine Krankheit an sich, sondern die Kinder mit ADS sind eben anders, aber nicht schlechter, in manchem sogar besser. Unerkannt, in ausgeprägter Form und unter zu großer Belastung kann das ADS aber zur Krankheit werden mit schweren Folgen für die seelische und körperliche Gesundheit akut und für die Zukunft des betroffenen Kindes. 
Nach eingehender Diagnostik wird mit den Kindern und deren Eltern ein individuelles Förder- und Therapieprogramm entworfen. Diese vielschichtige Therapie ist immer eine individuelle, systematisch organisierte Vorgehensweise, die das Verhalten, die Wahrnehmungsfähigkeit, die Empfindungen, die Reaktionen, die Aufmerksamkeit, die Sozialbeziehungen und die Eigenheiten des Kindes berücksichtigen muss.
Beispiel eines Behandlungskonzepts in der Praxis:
• Annahme des Kindes, so wie es ist. Das Kind ist immer die »Hauptperson«
• Schaffung eines Vertrauensverhältnisses zwischen Kind, Eltern und Therapeut
• Formulierung der Probleme mit dem Kind und seinen Eltern
• Schließen eines Arbeitsbündnisses und Anbieten von Hilfen zur Lösung der Probleme des Kindes und seiner Eltern
• Aufklärung der Eltern und des Kindes über ADS, Aufzeigen seiner negativen und positiven Seiten und des Unterschiedes von Nicht-wollen und Nicht-können
• Mitgabe von Informationsmaterial über ADS und Literaturempfehlungen, Kontaktaufnahme zu anderen betroffenen Eltern, Teilnahme am Elternseminar, Hinweise auf Bestehen einer Selbsthilfegruppe
Читать дальше