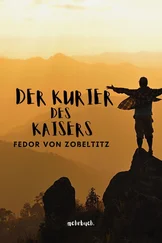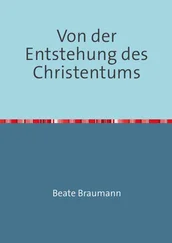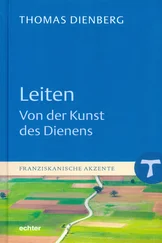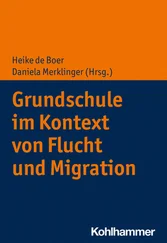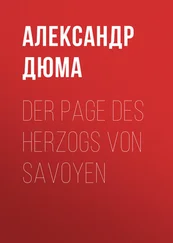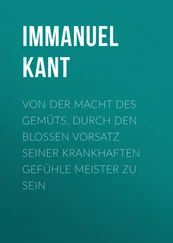Auswahl bedeutungsbezogener Genusregeln (nach Wegener 1995a: 69)
Ältere Deutschlernende fragen sich (berechtigterweise) oft, wozu man lernen muss, dass z. B. Schale weiblich und Krug männlich ist? Erhalten sie darauf keine befriedigende Antwort, kann eventuell die Motivation nachlassen, sich auf das komplexe Regel-System und seine Ausnahmen einzulassen, denn schließlich ist die Kommunikation nicht gefährdet, wenn man den falschen Artikel gebraucht. Aber: Die Textverstehensfähigkeit ist beeinträchtigt, wenn man das Genussystem nicht sicher beherrscht.
| (5) |
Der Krug 1 fiel in die Schale 2 , aber er 1 / sie 2 zerbrach nicht. |
| (6) |
Ich meine das Haus 1 neben der Kirche 2 , das 1 / die 2 gerade renoviert wird. |
| (7) |
Der Mann 1 sah die Frau 2 neben seinem 1 / ihrem 2 Auto stehen. |
Die drei Beispiele (aus Wegener 1995a: 66) veranschaulichen die Hauptfunktion von Genus. Sprachen, die über ein Genussystem verfügen, können mit Hilfe genusanzeigender Pronomen auf effiziente und oftmals disambiguierende Weise referenzielle Bezüge herstellen – auch über Satzgrenzen hinweg. Das Pronomen weist dabei immer das gleiche Genus auf wie sein Bezugsnomen. Der Rezipient muss, um Sätze und Textpassagen in der intendierten Weise zu verstehen, jedes Pronomen mit dem richtigen Bezugsnomen verbinden. Für MuttersprachlerInnen ist das (meist) kein Problem. Deutschlernende jedoch tun sich beim Lesen von Texten oftmals schwer mit der Interpretation von Pronomen. Wird aber das Sprachangebot von Anfang an so gestaltet, dass die kohärenzstiftende Funktion von Genus sichtbar wird, vgl. (8) und (9), dann sind die Lernenden zum einen motivierter, sich die Genuszugehörigkeit der Nomen zu erschließen und dabei auf Kongruenzrelationen zwischen den einzelnen Genusindikatoren (z. B. Artikel, Personalpronomen, Relativpronomen, Possessiva) zu achten. Zum anderen wird ihnen dann später beim Textverstehen die Interpretation von Pronomen kaum Schwierigkeiten bereiten, da sie wissen, dass sich Pronomen (meist) auf ein zuvor erwähntes Nomen beziehen. Und bei dessen Auffinden hilft ihnen die im Pronomen enthaltene Genusinformation.
| (8) |
Neben mir steht Lara 1 / Tarek 2 . Sie 1 / Er 2 hat heute eine Jeans an. Ihr 1 / Sein 2 Pullover ist rot. |
| (9) |
Wo ist der Ball 1 / die Tasche 2 ? Wer weiß, wo er 1 / sie 2 ist? Tom sucht ihn 1 / sie 2 . |
Neben der referenziellen Funktion kommt der Genuskategorie auch eine wichtige syntaktische Funktion zu, die insbesondere für weit fortgeschrittene Deutschlernende relevant wird. Typisch für die deutsche Bildungssprache sind hochkomplexe Nominalphrasen (siehe hierzu u.a. Petersen 2014). Zwischen Artikel und Nomen können sich mehrfach erweiterte Attribute schieben und eine große Distanz zwischen Artikel und Nomen verursachen, vgl. (10) bis (12).
| (10) |
derregelmäßig zum Jahrestag der Institutsgründung stattfindende Kongress |
| (11) |
dasvon den Kritikern in höchsten Tönen gelobte, bei der Leserschaft aber nicht besonders gut ankommende Buch |
| (12) |
diean dem Versuch, beide Parteien wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, beinahe gescheiterte Kanzlerin |
Diese Klammerbildung wird durch die Genuskongruenz zwischen dem genusanzeigenden Artikel und dem genusinhärenten Nomen ermöglicht, denn durch sie werden Anfang und Ende der komplexen NominalphraseNominalphrase angezeigt und somit leichter perzipierbar (Wegener 1995a: 65). (In Kapitel 13 kommen wir im Rahmen der vorzustellenden Erwerbsstudien noch einmal etwas genauer auf die Funktionen von Genus zu sprechen.)
Die NominalklammerNominalklammer – ein Schnittstellenphänomen von NominalflexionNominalflexion und Syntax – ist nicht die einzige Klammerkonstruktion des Deutschen. Auf sie lässt sich bis zum mittleren Sprachniveau jedoch gut und gern verzichten, nicht aber auf die sog. VerbalklammerVerbalklammer (bzw. Satzklammer), um die es in Kapitel 5 gehen wird.
 Aufgaben
Aufgaben
1.* Nennen Sie (mit Beispielen)drei bedeutungsbezogene Genuszuweisungsregelndrei formbezogene Genuszuweisungsregeln, zu denen es auch Ausnahmen gibtdrei formbezogene Genuszuweisungsregeln, zu denen es keine Ausnahmen gibt.
2.* Worin besteht die Hauptfunktion des Genussystems?
3.** Ein Kind (L1 Türkisch, Deutschkontakt 16 Monate) soll einen von der Lehrkraft (LK) vorgegebenen Satz nachsprechen. Wie zu erkennen ist, spricht es das Gehörte nicht einfach nach, sondern nutzt bei der Wiederholung sein eigenes zu diesem Zeitpunkt auf der Basis bisheriger Spracherfahrungen für die Zielsprache entwickeltes Regelsystem – man spricht auch von einer InterimsgrammatikInterimsgrammatik. Welche Genuszuweisungsregel wendet das Kind an und welche wäre erforderlich?LK: Das Rotkäppchen, das die Blumen pflückt, will die Großmutter besuchen. K: Die Rotkäpchen pflückt die Blumen. Sie sucht ihre Großmutter. (Wegener 1995b: 6)
4.*** Viele Deutschlehrwerke nutzen drei Farben, um die Zugehörigkeit der Nomen zu einem der drei Genera zu markieren. Verschaffen Sie sich anhand zweier oder dreier Lehrwerke für das Grundschulalter zunächst einen Eindruck über diese Visualisierungsform des grammatischen Genus. Ob bzw. wie sinnvoll diese ist, wird kontrovers diskutiert. Lesen Sie hierzu Pagonis (2015: 158-169) und positionieren Sie sich zu dieser Art der Formfokussierung.
Partner- und Gruppenaufgaben
5.** Stellen Sie sich vor, Sie würden im Unterricht hospitieren und erleben dabei folgendes Gespräch der Lehrkraft (LK) mit einem Mädchen (L1 Russisch, Deutschkontakt 11 Monate).K: Die Affe nehm ich nicht mit .LK: Die Affe ist bestimmt nicht richtig, weil es heißt ja nicht die Affe oder das Affe, sondern der Affe. Also? K: Der Affe nehm ich nicht mit. LK: Der Affe geht auch nicht. K: Mhm. Was geht denn dann? LK: Mit den. Also, sag nochmal. K: Den Affe fährt net mit oder so. LK: Ja, dann musst du sagen der. Der Affe fährt nicht mit, aber den – mit mitnehmen. K: Warum muss jetzt immer des ich machen? (Wegener 1995b: 6)Beschreiben Sie zunächst einmal die vielschichtige Problematik des Gesprächsverlaufs.Überlegen Sie dann zu zweit, wie angemessene Reaktionen auf die Äußerungen der Schülerin hätten aussehen können und bereiten Sie ausgehend vom ersten Satz der Schülerin „Die Affe nehm ich nicht mit“ eine kleine Szene der S-LK-Interaktion vor und präsentieren Sie diese vor der Seminargruppe. Reflektieren Sie gemeinsam Ihre Vorschläge.
6.** In Abb. 4.6 ist ein Auszug einer für das Vorschulalter geeigneten Fördereinheit zur Anbahnung des grammatischen Geschlechts dargestellt.Warum ist eine gezielte Auswahl an Objekten / objektdarstellenden Bildern notwendig? Nach welchen Kriterien wurden die Nomen für die Übung ausgewählt? (Zur leichteren Erfassung der Objektnamen wurden für die Illustration des Säckchens in Abb. 4.6 statt der Objektvisualisierungen die Wortformen angegeben.)Die Fördereinheit soll implizit an das Genussystem heranführen. Wie ist der InputInput hierfür strukturiert? Unterstreichen Sie in den Ausführungen alle genusanzeigenden Hinweise.Simulieren Sie zu zweit oder zu dritt mögliche Fortführungen des oberen oder unteren Gesprächs.LK:Nun wollen wir doch mal sehen, was da für Dinge (für Bildkarten) in unserem Grabbelsäckchen sind.Der Reihe nach darf jeder eine Karte rausnehmen und wir schauen, was dadrauf ist. (…)K1:BallLK:Ganz genau, das ist ein Ball. Wie sieht der denn aus? Welche Farbe hat der Ball?K2:blauLK:Stimmt, er ist blau – ein blauer Ball.mögliche Erweiterung bei einer späteren Wiederholung des Sprachspiels:LK:Was ist denn noch alles blau hier in unserem Kreis – schaut euch mal um …K3:Hose (zeigt auf die eigene Hose)LK:Ja, deine Hose ist blau. Und meine?K4:schwarzLK:Stimmt, meine Hose ist nicht blau, die ist schwarz. Aber schaut mal zu Tarek und Lia.K5:Hose blau (zeigt auf Tarek) und Lia auchLK:Gut beobachtet! Seine Hose ist blau (auf Tarek zeigend) und ihre Hose (auf Lia zeigend) ist auch blau. (…)Abb. 4.6:Auszug einer Fördereinheit zur Anbahnung des grammatischen Geschlechts
Читать дальше
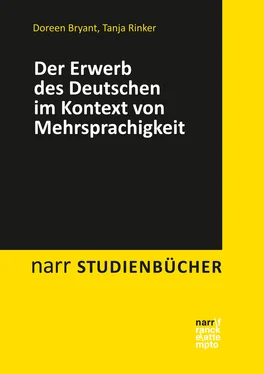
 Aufgaben
Aufgaben